Warten auf die immaterielle Arbeiterbewegung
(Dezember 2006)
Es ist stiller geworden um die Wissensgesellschaft. Zwar beschäftigt sich immer noch hauptberuflich eine Kommissarin der Europäischen Union mit ihr – eigentlich kümmert sie sich, trotz ihres Titels, um Informationstechnologien und Bildungsfragen – aber das unaufhörliche Gerede über die angeblich „gewichtslose Ökonomie“ ist leiser geworden. Das liegt vor allem daran, dass im Jahr 2001 mit den Aktienkurse auch viele Illusionen zusammenbrachen. Bevor die Finanzblase platze, wurde noch in allen Zeitungen, Programmen und Kanälen verkündet, Wissen und Informationsverarbeitung seien zur „entscheidenden Produktivkraft“ geworden und die große Industrie nur noch ein Anachronismus. Die Wende zur „Wissensgesellschaft“ stünde unmittelbar bevor und werde sogar bereits vollzogen.
Solche Redeweisen sind, vom digitalen Internet-Futurismus einmal abgesehen, nicht neu; sie stehen in engem Zusammenhang mit den Theorien über „die Dienstleistungsgesellschaft“ oder „die Tertiärisierung“. Es geht also um Ideologie, aber um eine wirkungsmächtige Ideologie. Im folgenden wird eine linke Variante dieser „Dienstleistungsideologie“ kritisiert, als deren Vertreter Manuel Castells, das Autorenteam Antonio Negri und Michael Hardt, André Gorz, Maurizio Lazzarato und Max Henninger gelten. Gemeinsamer Ansatzpunkt dieser Theoretiker (die sich in anderen Aspekten krass unterscheidet) ist der Begriff der „immateriellen Arbeit“. Mit ihrer Sehn-Sucht nach einer ganz neuen Qualität des Kapitalismus gehen und führen die „Wissenskommunisten“ in die Irre. Insbesondere gilt das, wo sie glauben, das Wertgesetz neu bestimmen oder als überholt darstellen zu müssen.
Ginge es dabei nur um eine weitere linksakademische Debatte, wäre es ausreichend, dass diejenigen sich mit ihr beschäftigen, die noch eine weitere Doktorarbeit zum Thema verfassen. Aber die Frage, ob Wissens heute in der kapitalistischen Produktion eine neue Rolle spielt, hat auch eine politische Bedeutung – nicht die entscheidende, aber doch eine große. In den Schulen und Universitäten (ansatzweise auch in Forschungseinrichtungen) auf der ganzen Welt finden soziale Kämpfe statt. Hier wird die Arbeitskraft produziert, von der die Globalisierung angetrieben wird. An der Urbanisierung und dem steigenden Bildungsniveau zeigt sich, dass neue Weltregionen in die kapitalistische Verwertung integriert worden sind. Insofern ist Bildung nicht akzidentiell, sondern ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil der globalen Ökonomie. Andererseits soll ein internationales Regime der Patente und Kopierrechte (GATT, TRIPS) die „Zirkulation von Wissen“ und „Kultur“ profitabel machen, was auf einen gewissen „passiven Widerstand“ der Konsumenten stößt. Manche Autoren erklären die Befürworter von „Freier Software“ oder „Open Source“ zur Gegenmacht, zu „Dissidenten des digitalen Kapitalismus“ (Gorz 2003: 9).
Um die politische Bedeutung dieser Auseinandersetzungen realistisch einzuschätzen, taugen die Phantasien eines Maurizio Lazzaratos sicher nicht. Aber entspricht dem Begriff der „immateriellen Arbeit“ nicht doch eine veränderte Produktion, wie sie heute „wissenschaftlich“, international zergliedert und computergestützt stattfindet? Hier wird die gegenteilige Ansicht vertreten und versucht, Bildungsökonomie materialistisch zu betreiben. Die theoretischen Überlegungen münden in Vermutungen, welche Rolle die Bildungsanstalten augenblicklich spielen und in der Zukunft voraussichtlich spielen werden.
Dieser Text trägt den Charakter einer theoretischen Selbstverständigung. Er soll einige Anregungen geben und hat keinen systematischen Charakter. Ziel ist, den hochspekulativen Höhenflügen einige konkrete Beobachtungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit entgegenzustellen. Ähnliche Kritiken finden sich übrigens bei Haug (2003) und Thompson (2005).

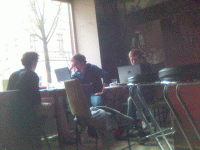
1. Leben wir in einer Dienstleistungsgesellschaft?
Bereits in den 60er Jahren fand eine ausgedehnte Debatte über die sogenannte „Tertiärisierung“ statt. Damit ist gemeint. dass der dritte wirtschaftliche Sektor (die „Dienstleistungen“) den primären (Landwirtschaft und Rohstoffgewinnung) und sekundären Sektor (Industrie) in der Menge der Arbeitenden beziehungsweise der Wertschöpfung übertrifft. An dieser Feststellung lässt sich vernünftig kaum zweifeln, wohl aber an den vielfältigen und oft widersprüchlichen Behauptungen, die davon abgeleitet werden. Denn die sogenannte Dienstleistungsgesellschaft ist angeblich vor allem eines nicht mehr: eine Klassengesellschaft wie die „Industriegesellschaft“.
Vorläufer dieser populären Redeweise waren die Diskurse über die „Integration der Arbeiterklasse“, die „Wohlstandsgesellschaft“ oder in Großbritannien “white heat of technology”. Wer „unsere Gesellschaft“ als Dienstleistungsgesellschaft bezeichnet, geht davon aus, dass der sogenannte dritte Sektor eine „bestimmende“ oder „überwiegende“ Rolle in ihr spielt. Die gängige Definition ist rein quantitativ: lebt die Mehrheit der Beschäftigten in einem Land von Dienstleistungen, sprechen die Soziologen von einer Dienstleistungsgesellschaft.
Allerdings sind die Statistiken, die sie in diesen Fällen heranziehen, oft wenig aussagekräftig, weil ihre Abgrenzungskriterien vage sind. Dazu kommen Verzerrungen durch Outsourcing. Weltweit, also der tatsächlichen Produktion entsprechend, arbeiten heute mehr Menschen als jemals zuvor in der Industrie. Noch stärker ist die industrielle Produktion gewachsen.
Schon insofern ist „Tertiärisierung“ auf einige Metropolenregionen beschränkt. Aber auch diese Kritik verfehlt den Kern der Dienstleistungsideologie, enthält sie doch unausgesprochen die Annahme, dass tatsächlich eine neue Qualität erreicht wäre, wenn bald die Mehrheit der Weltbevölkerung ihr Auskommen weder im Bergwerk, noch auf dem Acker oder in der Fabrik fände. Aber die Kategorie Dienstleistung ist an sich wenig aussagekräftig. Die Soziologie gibt unumwunden zu, dass es sich um eine nur negativ bestimmte „Restkategorie“ handelt. Alles, was nicht industrielle oder landwirtschaftliche Produktion beziehungsweise Rohstoffförderung ist, kommt in die große Schublade. „Dienstleistungen“ bezeichnet insofern ganz unterschiedliche Tätigkeiten und soziale Positionen. Der Schweizer Soziologe Werner Bätzing schlägt eine grundsätzliche Unterscheidung vor: diese Tätigkeiten sind entweder produktionsorientiert oder reproduktionsorientiert. Die einen sind „direkt auf den Produktionsprozess bezogen (Transport, Handel, Banken, Versicherungen, technische Wissenschaften, Verwaltung, Beratung, Werbung, Marketing)”, die anderen „indirekt (...), indem sie die Rahmenbedingungen schaffen beziehungsweise wieder herstellen, damit Menschen produktiv arbeiten können (Hausarbeit, Kindererziehung, Bildungs- und Ausbildungswesen, Gesundheitswesen, Sozialarbeit, Freizeitindustrie) und damit ein Gemeinwesen produktive Arbeiten fördern kann“. (Bätzing 2005: 57)
Diese sehr sinnvolle Unterscheidung nähert sich einer qualitativen Bestimmung der Sektoren untereinander an, aber für unsere Zwecke ist noch eine weitere nötig: kann die Dienstleistung von einer Maschine ausgeführt werden oder ist menschliche Arbeitskraft nötig? Es ist entscheidend, ob die erbrachte „Dienstleistung” wenigstens potentiell automatisierbar ist, weil der „kreative Charakter” bestimmter Arbeiten unter Umständen einen gewissen Schutz vor Rationalisierung, Aufspaltung und Verdichtung bietet – ein Aspekt, der uns noch beschäftigen wird.
DIENSTLEISTUNGEN
| automatisierbar | "kreativ" | produktionsorientiert |
| reproduktionsorientiert |
Das führt zu wichtigen Unterschieden in der sozialen Position und Verhandlungsmacht der „Dienstleister“, die in den Texten der „Wissenskommunisten“ über die immateriellen Arbeiter an keiner Stelle systematisch diskutiert werden. Kein Wunder, manche Argumentation fände ein so abruptes wie verdientes Ende.
Das Verhältnis der Sektoren muss als qualitatives statt nur quantitatives begriffen werden. Nur die gestiegene Produktivität eines Sektors macht das Wachstum des nächsten möglich; erst die größere Produktivität der Landwirtschaft macht die industrielle Revolution möglich, erst die Produktivität der Industrie kann eine Dienstleistungsgesellschaft erhalten. Der Dienstleistungssektor ist für viele für ehemalige Industriearbeiter ein Auffangbecken, aber längst nicht für alle: nicht nur dieser Bereich wächst, sondern auch die Arbeitslosigkeit – übrigens auch in den Schwellenländern! Stur und etwas dogmatisch soll hier deshalb zunächst festgehalten werden: ob wir in einer Dienstleistungsgesellschaft leben oder nicht, bestimmt leben wir in einem Kapitalismus, der erstens nach wie vor auf industrielle Produktion nicht verzichten und zweitens seine grundlegenden Widersprüche nicht lösen kann.


2. "Wissen als Produktionsfaktor"?
Dem werden auch die Wissenskommunisten nicht widersprechen. Aber trotz eines ganz verschiedenen Erkenntnisinteresses und theoretischen Anspruchs gibt es zahlreiche Berührungspunkte zwischen der linksradikalen Rede von der immateriellen Arbeit und der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft und Managementliteratur. Dem „Wissen als Produktivkraft“ entsprechen die “intagible assets”, den „Gemeingütern“ die „natürlichen Monopole“, den „immateriellen Arbeitern” die „Symbol-Analytiker“. Ihr gemeinsamer Ausgangspunkt ist die Annahme, wir lebten in einer „Wissensgesellschaft”. Die taucht bekanntlich in jeder dritten Politikerrede und jedem vierten Leitartikel auf. Wissen soll „immer wichtiger“ werden, zur „eigentlichen Produktivkraft“: „Zum ersten Mal in der Geschichte ist der menschliche Verstand eine unmittelbare Produktivkraft und nicht nur ein entscheidendes Element im Produktionssystem.“, heißt es bei Manuel Castells (2001: 34).
Während dem Dienstleistungsdiskurs noch tatsächliche Phänomene entsprechen, ist die Rede von der Wissensgesellschaft völlig diffus. Der Anteil von Wissen an einer bestimmten Arbeit ist grundsätzlich unmessbar, sie ist in jedem Fall die „Verausgabung von Hirn und Hand“ (Marx). Was kann Castells meinen, wenn er Wissen zur „unmittelbaren Produktivkraft“ erklärt? Dass Wissen als Lohnarbeit für das Kapital produziert wird und Mehrwert schafft, ohne sich in Waren zu vergegenständlichen? Wohl kaum. Dass Wissen als Produktionsfaktor eingekauft wird? Dann müsste das Kapital es auf der Kostenseite verbuchen. Es kauft aber (abgesehen von dem Sonderfall des franchising oder das lizensierte Recht, ein Verfahren anzuwenden) kein Wissen als solches, sondern die Arbeitskraft, die ihre Qualifikation, ihr Wissen und ihre Subjektivität mitbringt. Das „lebendige Wissen“ (Gorz 2004) ist an ein Subjekt gebunden, es zirkuliert nicht. Es ist kein Produktionsmittel, sondern Arbeitsvermögen. In der Produktion nehmen wir verdinglichtes, kodifiziertes Wissen auf, wenden es an und „verflüssigen“ es. Diese Unterscheidung gerade nicht zu machen, charakterisiert den wissenskommunistischen Diskurs. In ihrer Diktion ist das Wissen der immateriellen Arbeiter Produktionsmittel und Produkt in einem.
Die Produktion der Arbeitskraft durch Bildung ist widersprüchlich, prekär, störungsanfällig. Die staatliche Aufgabe, dieses Arbeitsvermögen herzustellen, ergänzt das kurzsichtige Interesse der einzelnen Kapitalien, ausgebildete Arbeiterinnen und Arbeiter auf dem Markt vorzufinden. Die Gestehungskosten des für die Verwertung nötigen Wissens aber bezahlt das Kapital nicht oder nur zum Teil. Das gilt für Forschung und Wissenschaft ebenso wie für Schulen und Universitäten. Die Kosten werden auf die Gesamtheit der Arbeitenden (vermittelt durch den steuererhebenden Staat) beziehungsweise auf die einzelnen zukünftigen Lohnabhängigen selbst abgewälzt. Für das Kapital handelt es sich beim „Wissen“ um eine Externalität. Dasselbe gilt für jene ambivalente Subjektivität, die in den Stand versetzt, sein Leben als Lohnarbeit zu verausgaben. Im Bezug auf die Naturwissenschaft heißt es bei Karl Marx:
„Wie mit den Naturkräften verhält es sich mit der Wissenschaft. Einmal entdeckt, kostet das Gesetz über die Abweichung der Magnetnadel im Wirkungskreise eines elektrischen Stroms oder über Erzeugung von Magnetismus im Eisen, um das ein elektrischer Strom kreist, keinen Deut.“ (1972: 407)
Offensichtlich setzt sich das für die Arbeit nötige Wissen aus normierten Qualifikationen (Schul- und Berufsabschlüssen) einerseits und Kulturtechniken, Erfahrungen und „implizit Gewusstem“ andererseits zusammen. Deren Verhältnis unterscheidet sich je nach Art der Arbeit. In den Schriften der Wissenskommunisten finden sich solche Unterscheidungen nicht. Sie betonen das Unmessbare, Kulturelle und Flüchtige, ohne weiter auf die verdinglichten Formen einzugehen (Gorz 2004: 17). Dadurch scheint es, als produziere die Gesellschaft Wissen unabhängig von Staat und Kapital und übrigens auch allen materiellen Beschränkungen. In der Zirkulation von Wissen soll die freie Assoziation schon verwirklicht sein. Für sie hat das Kapital sich nicht nur die Gesellschaft untergeordnet, sondern es gibt nichts mehr außerhalb des Kapitals. So heißt es beispielsweise bei Lazzarato: „Der Verwertungsprozess (fällt) tendenziell mit dem Prozess (zusammen), in dem gesellschaftliche Kommunikation produziert wird.“ (1998: 53)
Um aber für das Kapital interessant zu sein, muss sich die immaterielle Arbeit (beispielsweise die von Kulturproduzenten) in Waren oder Dienstleistungen verdinglichen und dann auf dem Markt realisiert werden. Wenn Lazzarato oder Negri die Zirkulation von Wissen, Sprache und „biopolitisch“ Leben mit der Zirkulation von Waren in eins setzen, treiben sie nicht nur den Fetischismus auf die Spitze, sondern ignorieren den notwendigen Durchgang durch die Geldform.
„Der Prozess der gesellschaftlichen Kommunikation ist mitsamt seinem Hauptinhalt, der Produktion von Subjektivität, unmittelbar produktiv geworden“, glaubt Lazzarato (1998:58). Das Mantra, Kommunikation oder Subjektivität seien „unmittelbar produktiv”, ist aber noch aus einem weiteren Grund missverständlich. Bekanntlich ist nicht jede Lohnarbeit auch produktiv im Sinne des Kapitals. „Produktive Arbeit ist bloß die, die Kapital produziert. Ist es nicht verrückt, (...) daß der Klaviermacher ein produktiver Arbeiter sein soll, aber der Klavierspieler nicht, obgleich doch ohne den Klavierspieler das Klavier ein Unding wäre? Aber so ist es exakt. Der Klaviermacher reproduziert Kapital; der Klavierspieler tauscht seine Arbeit nur gegen Revenue (= Mittel zum Lebensunterhalt/Privatkonsum) aus. Aber der Klavierspieler produziert Musik und befriedigt unseren Tonsinn, produziert ihn auch gewissermaßen? In der Tat so tut er: seine Arbeit produziert etwas; darum ist sie nicht produktive Arbeit im ökonomischen Sinne; so wenig als die Arbeit des Narren produktiv ist, der Hirngespinste produziert. Produktiv ist die Arbeit nur, indem sie ihr eigenes Gegenteil produziert.“ (K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 212)
Die bürgerliche Wirtschaftswissenschaft und Wissenskommunisten behandeln Qualifikation – die Fähigkeit, eine bestimme Arbeit auszuüben – entweder als „Gemeingut“ oder als „Positionsgut“, ohne deren Widerspruch zu thematisieren. Als Konkurrenzsubjekt hat ein Proletarier, der eben nur Besitzer seiner Arbeitskraft ist, kein Interesse an der Verallgemeinerung "seines Wissens". Der „Wert seiner Qualifikation“ wird bestimmt durch die Menge der außer ihm noch vorhandenen Arbeiter mit der gleichen Fähigkeit. Bildungsökonomen sprechen beispielsweise oft von Abschlussinflation, also der Entwertung von Bildungstitel durch ein Überangebot. Schon deshalb ist die Behauptung von André Gorz oder Toni Negri verstiegen, immaterielle Arbeit sei „eigentlich“ bereits kommunistisch. (Später soll entwickelt werden, wie der Zwiespalt Positionsgut / Gemeingut den Charakter der Kämpfe im Bildungsbereich prägt.)
Inwiefern ist dann Bildung überhaupt ein Gemeingut, also etwas, von dem sich Nutzer nicht sinnvoll ausschließen lassen? Insofern sich Wissen allgemein schlecht als Ware eignet, nicht im Sinne der globalisierungskritischen Parole „Bildung ist keine Ware“, die Sein und Sollen verwechselt und ein harmloser normativer Fehlschluss ist. Bildung ist natürlich (auch) Ware, aber jenes gesellschaftliche Verhältnis, das sie zur Waren macht, muss sich mit natürlichen Gegebenheiten auseinandersetzen. Unterschiedliche „Materialien“ eignen sich unterschiedlich gut für die Warenform. Ein paar Beispiele auf ganz unterschiedlicher Ebene, um das deutlich zu machen:
Wissen ist wiederum ein Sonderfall. Es ist so nötig für die Produktion von Stahl wie Kohlen. Aber dieses nötige Wissen wird nicht in seiner Anwendung zerstört wie Kohle. Es kann nicht verbraucht werden, mehr noch: es wächst mit seiner Anwendung. Das Prinzip des Wissens ist anti-ökonomisch: wer es teilt, vermehrt es. Erving Goffman findet einen passend paradoxen Ausdruck für diesen Sachverhalt: „Von allen Dinge lässt sich Wissen am schwierigsten bewachen, denn es kann gestohlen werden, ohne dass es weggenommen wird.“
Um als Ware zu taugen, muss Wissen mit einem Eigentumstitel versehen werden, durch ein staatliches Zertifikat (wie im Fall der Universitätsabschlüsse), durch ein Patent oder Copyright. (Laut gängiger Definition schützen Patente eine Idee, das Kopierrecht ihren Gebrauch.) Gibt es eine staatliche Garantiemacht, ist das durchaus möglich. Obwohl durch Internet und weltweite Industrialisierung Bildung und Informationsmöglichkeiten wachsen, erleben wir nicht das Entstehen eine Wissensallmende, sondern durchlaufen eine Phase der enclosures! Das beste Beispiel dafür ist das Abkommen über Trade-Realted Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), mit dem ein weltweites Copyrights-Regime etabliert werden soll, um die Zirkulation des Wissens wenigstens einzuschränken.
Während Wissen in seiner „flüssigen Form“ an Individuen gebunden ist und sich nur in ihrer Arbeit verdinglicht, ist es in seiner „festen“, verdinglichten und kodifizierten Form eine Handelsware. Welche ökonomische Rolle spielt letzterer? André Gorz analysiert franchising ganz klar: das formalisierte Wissen (ein Verfahren, eine Formel oder im Extremfall ein Markenzeichen) wird sozusagen zum fixen Kapital des Lizenznehmers. Sein Gewinn ist eine Monopolrente. Dieser Anteil aber steigert nicht die Produktivität, sondern wird nur reproduziert, wenn der Lizenznehmer den Lizenzgeber bezahlt. Es senkt dessen Gewinn, Wert wird zwischen den beiden umverteilt, nicht geschaffen.
Der schwierigste Aspekt des wissenskommunistischen Theorie ist die Haltung zum sogenannten Wertgesetz, dass bekanntlich besagt, der Wert bestimme sich letztlich nach der Menge der verausgabten „abstrakten Arbeitszeit“. Die Wissenskommunisten berufen sich auf die Grundrisse von Karl Marx, um die Arbeitswertlehre für überholt zu erklären. Die durch Mikroelektronik, Informatik und Biotechnologie weiter gestiegene Produktivität zersetzt angeblich ihre Kategorien. Die produktiven Tätigkeiten der Menschen lassen nicht mehr vergleichen oder danach unterschieden, ob sie einfach oder komplex sind.
Die Durchsetzung dieses „Gesetzes“ hat aber die Konkurrenz zur Vorraussetzung. Erst sie führt zur Durchschnittsprofitrate. Alle einzelnen Kapitalien streben nach Extraprofite. Franz Nataer (2005: 15 f.) zählt folgende Möglichkeiten auf, Extraprofite zu erzielen:
Aus dieser Perspektive sind die Aktivisten von „freier Software“ und „Open Source“ – André Gorz’ „Dissidenten des digitalen Kapitalismus“ (2003: 9) – diejenigen, die dem Wertgesetz erst Geltung verschaffen, indem sie die Austauschbarkeit der Software erzwingen und dadurch die Größe der verausgabten Arbeitszeit erst wieder ins Spiel bringen. (Nataer 2005: 11) Es ist also nicht so, dass das Wertgesetz gleichzeitig „gilt und nicht gilt“, sondern in bestimmten Bereichen setzt es sich schneller und gründlicher durch als in anderen. Unter den erwähnten Methoden, sich Extraprofite längerfristig zu sichern, ist eine, den Waren „eine individuelle Note zu verleihen“. Diese Strategie hat sich in seit den 80er Jahren noch weiter verbreitet, aber sie begründet keine neue Produktionsweise. Und auch ein Markenprodukt braucht letztlich einen Gebrauchswert. Wegen der oben genannten, das Wertgesetz verzerrenden Effekte scheint es, als sei es obsolet. Verzerrungen kommen weiterhin dadurch zustande, dass der Staat sozialarbeiterische und kulturelle Dienstleistungen finanziert, die wiederum einen großen Teil der prekären Intellektuellen über Wasser halten.


3. Wie charakterisieren die Wissenskommunisten die immateriellen Arbeiter?
Wie der klassische italienische Operaismus suchen die Wissenskommunisten nach einer zentralen Arbeiterfigur. Diese prägt angeblichen den wirtschaftlichen „Leitsektor“, der die anderen entweder an Produktivität oder Bedeutung übertreffen soll. Das prädestiniere diese Arbeiterfigur zum revolutionären Subjekt. Die Suche nach revolutionärer Subjektivität soll hier keineswegs ins Lächerliche gezogen werden, wie das linke Mode ist. Der Figur des Wissensarbeiter aber, die sich in den Texten der Wissenskommunisten finden, taugt nicht zur Analyse, nur zum Postulat.
Wie lässt sich ihre Arbeit beschreiben? „Die Tendenz zur fortschreitenden Abstraktion der Arbeit ist verschwunden“, schreibt Antonio Negri (Zwanzig Thesen zu Marx). „Die politische Zusammensetzung des Proletariats ist wie sein Terrain sozial, in Begriffen der Arbeitssubstanz ist es vollständig abstrakt, immateriell und intellektuell, in Begriffen der Arbeitsform ist es mobil und polyvalent.“
Wo finden sich die immateriellen Arbeiter? Laut Max Henniger in den Bereichen „Werbung, Design, Mode, Informatik und Kultur“. Sie sind „an keinen festen Arbeitsplatz und somit auch an keinen einzelnen Betrieb gebunden“ (2005). Nimmt man diese Definition ernst, handelt es sich bei den immateriellen Arbeitern um eine winzige Schicht (in der die Debatte allerdings großen Anklang findet). Die Gruppe Intellektueller in den Metropolen, die „ihr Gespür für gesamtgesellschaftliche Trends“ in einen Lebensunterhalt umsetzen kann, zum „zentralen Entwicklungsfaktor in der kapitalistischen Weltwirtschaft“ zu erklären, wie Henninger es tut, ist fern jeder Realität. (Übrigens nimmt deren Produktion durchaus dingliche Gestalt an, die von Medienwaren. Der Einwand, diese seien nur Zwischenschritt in der „Produktion von Bedeutungen und Phantasien“ geht fehl: Jedes Brot ist ein Zwischenschritt bei der „Produktion von Genuss und Sättigung“.) Auf die Schicht der Kulturproduzenten wollen Autoren wie Negri die Wissensarbeiter auch gar nicht beschränkt sehen: für sie sind die Wissensarbeiter ein avantgardistischer Teil des Proletariats, die Kerntruppe der Multitude. Aufgrund der ganz schwammigen Definitionen können einmal die thailändische Reinigungskraft, ein anderes Mal der hochqualifizierte und gut bezahlte Software-Entwickler als immaterielle Arbeiter gelten.
In welchem Verhältnis stehen die immateriellen Arbeiter untereinander? „Indem sie ihre eigenen schöpferischen Energien ausübt, setzt die immaterielle Arbeit das Potential für eine Art des spontanen und elementaren Kommunismus frei.“ (Negri / Hardt : 37) Oder: „Der Zyklus der immateriellen Arbeit ist durch eine gesellschaftliche und autonome Arbeitskraft bestimmt, die ihre eigene Arbeit und ihre Beziehungen zum Betrieb selbst zu organisieren vermag. Kein >wissenschaftliches Management< kann über dieses gesellschaftliche Vermögen und diese kreative Produktivität bestimmen.“ (1997: 24)
In welchem Verhältnis stehen sie zur Maschinerie? „Der general intellect fällt mit der Kooperation zusammen, mit dem Konzert der lebendigen Arbeit, mit der kommunikativen Kompetenz der Individuen.“ (Virno 2005: 64). Der Rekurs der Wissenskommunisten auf künstlerischen Tätigkeiten, um die neue Qualität der Arbeit zu beschreiben, ist notorisch; Gorz vergleicht die immaterielle Produktion mit einer musikalischen Improvisationssession etc.
Die Rede von der Selbstverwertung oder der autonomen Organisation der Arbeit ist angesichts des Arbeitsalltags der meisten Menschen, auch der Kulturproduzenten, fast zynisch. „Der Zwang, dem die scheinselbständigen Kreative oder der Heimarbeiter unterliegen – den Akkord zu verinnerlichen, beziehungsweise die – an der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit gemessen – zu niedrigen eigenen Produktivität durch die Ausweitung des Arbeitstages zu kompensieren, darf nicht mehr als vermittelte kapitalistische Ausbeutung ins Bewußtsein treten. Er wird stattdessen zum Vorschein des Kommunismus beziehungsweise im weiteren Verlauf zu jenem selbst verklärt.“ (Benl 2006: 47 – 8)
Die Debatte um die immateriellen Arbeit fällt hinter den Begriff der Kulturindustrie zurück. „Der Ausdruck Industrie ist dabei nicht wörtlich zu nehmen. Er bezieht sich auf die Standardisierung der Sache selbst (...) und auf die Rationalisierung der Verbreitungstechniken, nicht aber streng auf den Produktionsvorgang. Während dieser in dem zentralen Sektor der Kulturindustrie, dem Film, technischen Verfahrensweisen, durch weitergetriebene Arbeitsteilung, Einbeziehung von Maschinen, Trennung der Arbeitenden von den Produktionsmitteln, sich anähnelt – diese Trennung spricht im ewigen Konflikt zwischen den in der Kulturindustrie tätigen Künstlern und den Verfügungsgewaltigen sich aus – werden individuelle Produktionsformen gleichwohl beibehalten. (Adorno 2002: 339) Wer sich unter Industrie natürlich nur einen rauchenden Schornstein und eine große und schmutzige Fabrikhalle vorstellen kann, ist von der Kulturindustrie enttäuscht.
Bei der Analyse der Kulturproduktion müssen wir uns vor leeren Analogien hüten. Im diesem Sektor lassen sich die Waren ohnehin nicht einfach gegeneinander austauschen, sie haben einen notwendigerweise einzigartigen Charakter. Die Industrie kann und will auf diesen auch gar nicht verzichten, nur wäre sie gerne in der Lage, ihn gezielt und ohne die Gefahr von Verlusten einzusetzen: die Besonderheit einer Kulturware ermöglicht den Extraprofit, der wegen verschwindender Grenzkosten besonders üppig ausfällt.
Daher der Begriff der Virtuosität, jeder Arbeitsakt produziert sozusagen ein Einzelstück. Wo aber sinnvoll von Virtuosität gesprochen werden kann, handelt es sich nicht um Proletarier. Für die virtuosen Produzenten gilt das gleiche wie für die Kapitale: Extraprofite lassen sich nur machen, wenn keine Vergleichbarkeit der Produkte gegeben ist und sich daher das Wertgesetz und die Durchschnittsprofitrate nicht durchsetzen. Alle Medienproleten kennen die Bedeutung informeller Netzwerke. Auf einem (fiktiven) idealen Markt setzt sich der billigste Anbieter durch, glücklicherweise existiert er nicht. Die Produktivität der Medienproduzenten findet ihre Grenze in der Aufnahmefähigkeit des Publikums, die letztlich den Gebrauchswert der Medienwaren bestimmt: sie lässt sich nicht beliebig steigern und hängt mit der abstrakten Zeit zusammen, die für die Reproduktion zur Verfügung steht.
Den italienischen Genossen ist dabei zugute zu halten, dass sie von einer besonderen historischen Erfahrung ausgehen: der Jugendrevolte 1977, als sich das Aufbegehren gegen die Fabrikgesellschaft mit der immanenten Notwendigkeit traf, diese grundlegend umzuwälzen: sie ließ sich kaum noch beherrschen und profitabel betreiben. Die autonomen Schüler und Studenten trieben mit ihrem Auszug aus der Fabrik, der traditionellen Familie und den alten Parteien und Gewerkschaften das Ende des Fordismus voran. Ihr Individualismus, ihre Freude am Experimentieren mit neuen Lebens- und Kommunikationsformen wirkten als Innovationsschub, ihr rebellischer Impuls wurde kulturindustriell aufgenommen und sie selbst zu Pionieren und Schrittmachern der kapitalistischen Modernisierung Italiens – ein nur zu bekanntes Muster von Revolte, Integration und Modernisierung.
Nanni Ballestrini, Autor von „Wir wollen alles!“ und selbst Zeitzeuge der Revolte der 70er, führt die Wucht der Erhebung auf den besonderen Modernisierungsbedarf und Reformstau in der italienischen Gesellschaft zurück. Außerdem waren die italienischen Autonomen in vieler, oft paradoxer Weise Erben der parteikommunistischen Kultur. Die Besonderheit dieser Konstellation wird weder von Paolo Virno oder einem anderen Anhänger der Theorie von der „immateriellen Arbeit“ berücksichtigt. Weiter wäre zu fragen, ob sich in den fast 30 Jahren seitdem nicht einiges geändert hat. Wurde damals selbständig im Sinne von Freiberufler sein noch mit Autonomie verbunden, ist diese Unabhängigkeit der doppelt freien Mitarbeiter heute fassadenhaft zum Extrem. Sergio Bologna bringt es auf den Punkt: „Der implizite Sozialpakt, den die selbstständig Arbeitenden mit dem postfordistischen System unterzeichnet haben (Deregulierung der Arbeit im Tausch gegen die Sicherheit des Geldwerts) ruht auf immer zerbrechlicheren Fundamenten.“ (2006: 37)
Aber selbst wo „Selbstständigkeit“ nicht nur ein Manöver zur Entlastung der Sozialkassen ist, hat sie mit (Markt-)Macht nur selten etwas zu tun. Das gilt auch für die Kulturproduktion. In der Filmindustrie war früher die Rede von sogenannten Rucksackproduzenten, kleine Produktionsfirmen, die sich oft nur für eine Produktion gründeten und danach wieder auflösten. „Diese Prozesse ... schließen oft eine Beziehung zwischen unternehmerischer Produktion und Distribution einerseits und halb-autonomer oder kleinbürgerlicher Warenproduktion andererseits ein. Musik, Film und Fernsehen sind die besten Beispiele für die Einschließung von ‚kreativer Arbeitskraft’ in der kulturellen Produktion, bei der Kreativität eingekauft oder aus der Struktur der Konzerne ausgelagert wird.“ (Clarke 2000: 289) Für das Medienkapital haben solche Arbeitsverhältnisse nur Vorteile: Risiko wird auf die Zulieferer abgewälzt. Für viele Kulturproduzenten ist die Stellung als „Freischaffender” objektiv schlechter als ein Angestelltenverhältnis. Große Kapitale kontrolliert die Vervielfältigung und Distribution. Die angeblich sich selbst verwertenden Kulturproduzenten beliefern riesige transnationale Medienkonzerne.


4. Bemerkungen über aktuelle Entwicklungen der "Wissensarbeit"
„Die ökonomische Herrschaft könnte nicht vom Kapital ausgeübt werden, wenn die technologische eine Sache der Arbeiter wäre.“ (Sohn-Rethel 1989: 7)
Wesentliche Entwicklungen tauchen in den Theorien über die „immaterielle Arbeit“ gar nicht auf. Es folgen einige Beobachtungen, die jene triumphalistische Reden eines Negri gründlich lächerlich machen.
Der Fortschritt der Maschinerie bedingt nicht notwendigerweise eine anspruchsvollere Arbeit, aber ebenso wenig die Dequalifizierung. Sie tut beides: Tätigkeiten wie Wartung und Aufsicht werden komplexer und anspruchsvoller, die verbliebene Anwendung oft noch geistloser. Heute erleben wir die Taylorisierung der geistigen Arbeit, wo immer das möglich ist. Geistige Arbeit wird in Teilen automatisiert, (international) aufgespalten, beschleunigt und verdichtet. „Keineswegs (macht) – wie das oft behauptet wird – die Aufspaltung und Dequalifizierung aller Tätigkeiten zu repetitiven Teilarbeiten das Zentrum des Taylorismus (aus); der Kern der Taylorschen Doktrin besteht vielmehr in der Trennung von Wissen (der Verfügung über die Erzeugung, die Manipulation und die Verwendung von Informationen) als Basis der Möglichkeit der Disposition (also von Herrschaft) einerseits, von Ausführung als abhängiger Tätigkeit, die dadurch zum Gegenstand eines Informationsprozesses und damit beherrschbar wird, andererseits.“ (Schmiede 1992)
In ihrer Untersuchung über Call Center spricht die deutsche Industriesoziologin Holtgrewe von „Informationsarbeit“, die im sogenannten Service und der Kundenbetreuung um sich greift. Damit meint sie „quasi-industrielle Produktion mit schematisierten Kommunikations- und Interaktionsabläufen“. Kreativität oder Originalität haben hier höchstens in klar umgrenzten Reservaten Platz, die Subjektivität solcher immateriellen Arbeit ist durchaus zerbrechlich: „Weil ja die Verstehens- Interpretations- und Kommunikationsleistungen, die Empathie und Freundlichkeit der Beschäftigten unvermeidlich benötigt werden, werden diese in die Kontrolle und Rationalisierung ihrer Arbeit eingespannt. Diese Zugriffe auf Subjektivität wiederum lassen diese nicht unberührt, sondern formieren sie selbst.“ (2001: 58).
Um sich zu erhalten, muss auch die Subjektivität der immateriellen Arbeiter ein erträgliches Auskommen sichern. Das gilt längst nicht für alle in diesem Bereich Tätigen. Hier müssen die Brüche kritisch aufgespürt und zugespitzt werden, statt das Loblied der Kreativität anzustimmen. Dass „die Kontrolle in die Subjekte selbst verlagert“ wird (Lazzarato), ist weniger ein diskursiver Effekt, sondern an konkrete Organisationsformen gebunden und ruht auf einem dinglichen Fundament.
Das Mittel der Wahl ist heute, bestimmte Arbeitskontingente mit in einer Mindestzeit zu verbinden, dadurch erübrigt sich die ständige Überwachung: am Ende sind die Patienten entweder versorgt, die Werbeprospekte verteilt, die Wände gestrichen – oder eben nicht. Oft kommt es dadurch zu einer Verlängerung des Arbeitstages. In der wissenskommunistischen und Managementliteratur wird diese Strategie als „Führen durch Ziele“ beschrieben. Sie findet aber keineswegs nur dort Anwendung, wo es sich um „kreative Arbeit“ handelt, bei der die Kooperation selbst und diskursiv hergestellt wird.
Wo „Führen durch Ziele“ nicht möglich ist, wird der Druck des Marktes durch „Steuersignale der Rentabilität” (Haug) unmittelbar an die Arbeiter weitergegeben; Vorarbeiter und Aufsichtspersonal können eingespart werden.
Die Taylorisierung der geistigen Arbeit zeigt sich in der voranschreitenden Verbreitung von elektronischen Medien in allen Lebensbereichen. Demnächst werden beispielsweise an Berliner Universitäten Vorlesungen als Life Stream im Internet angeboten, wodurch auch die Dozenten unter Druck geraten werden. Andererseits übernehmen Konsumenten selbst heute immer mehr Aufgaben, die früher von Verkäufer und Wartungspersonal ausgeführt wurde. Lebendige Arbeit wird ersetzt durch Selbstbedienung an Automaten und im Internet. Nur durch elektronische Medien und Datennetze ist es möglich, die Produktion räumlich zu streuen und gleichzeitig die Kooperation und Kontrolle der Arbeiter zu gewährleisten.
Die Durchdringung des Lebens mit Maschinen kennt keine natürliche Grenze. Sie trifft höchstens auf aktiven oder passiven Widerstand der Gesellschaft. Die massiven Investitionen des Filmkapitals in computeranimierte Produktionen, durch die die Löhne von Schauspielern, Kameraleuten, Dekorateuren etc. unter Druck geraten, ist da ein noch harmloses Beispiel. Beängstigender sind Versuche, die in Japan stattfinden, die Altenpflege und Rehabilitation durch Roboter zu ergänzen. Weiteres Beispiel: digitale Sprachgenerierung für Lautsprecheransagen.
Tatsächlich können viele Metropolenbewohner Freizeit und Arbeit kaum noch voneinander unterscheiden. Dass sich die Grenze zwischen den Sphären tendenziell auflöst, erleben viele als äußerst leidvoll. Inn der Zirkulation ist ein deutliches Indiz das sogenannte „Outsourcing auf den Kunden“ (Günther Voß): die Unternehmen rationalisieren, indem sie die Käufer aktiv einbinden. Sie suchen im Internet aus, holen die Waren ab und bauen sie selbst zusammen, schließlich kümmern sie sich um deren Funktionieren.


5. Bildung – weltweite Produktion der Arbeitskraft?
„„Als gebildet mag gelten, wer alles tun kann, was die anderen tun.“ Hegel
Abschließend einige Überlegungen zu den durchaus stattfindenden Kämpfen im Bildungssektor. Zunächst sollen ihre Widersprüche benannt werden, um dann allgemein zu bestimmen, warum Bildung dennoch als Teil der gesellschaftlichen Wissensproduktion überhaupt wichtig ist.In ihrer Untersuchung über Arbeitskämpfe seit 1870 prognostiziert Beverly Silver, dass eine neue Welle von Auseinandersetzungen im internationalen Transportsektor einerseits und im Bildungsbereich andererseits bevorsteht (2003). Grob unterscheidet Silver zwischen Produktionsmacht und Organisationsmacht (13 – 16), also der Fähigkeit, die Verwertung zum Stocken zu bringen, und dem Einfluss durch Arbeiterorganisationen. Während aber die Macht der Arbeiterinnen und Arbeiter im Transport noch einigermaßen direkt ist, ist sie in der Bildung nur vermittelt gegeben. Die weltweite Produktion bedingt, dass die Waren über den Planeten verteilt werden müssen, um ihren Wert zu realisieren, ein Streik der Transporteure trifft das Kapital unmittelbar. Ebenso sind die Qualifikationen der Arbeitenden unverzichtbar, ohne sie entstehen erst gar keine Waren.
Aber ein Streik der Bildungsarbeiter unterbricht die Verwertung nicht. Deshalb ist es missverständlich, etwa von der „Produktionsmacht der Lehrer“ zu reden. Die Proteste der Lehrer, Dozenten und Studenten müssen politischen Druck entfalten. Sie richten sich notwendigerweise an den Staat, der das gesamtgesellschaftliche Interesse vertritt, für produktive Arbeiter zu sorgen. Dabei zeigt sich in den Protesten eine widersprüchliche Dynamik zwischen Lehrenden und Lernenden: treten beispielsweise Uni-Dozenten oder Schullehrer in einen Streik, protestieren oft ihre Schüler und Studenten dagegen. Einerseits üben sie so Druck aus, um den Streik zu beenden, andererseits auf den Staat beziehungsweise den privaten Arbeitgeber einer Bildungseinrichtung, die Forderung der Streikenden zu erfüllen. Die Durchsetzungsmacht der einen Seite braucht die der anderen, wobei es gar nicht nötig ist, dass sie sich explizit miteinander solidarisieren.
Die Kämpfe in der Bildung sind von zahlreichen Widersprüchen geprägt: die Entwicklung der Maschinerie und die Globalisierung bedingt ein steigendes Bildungsniveau weltweit. Wie ließe sich sonst das Proletariat eines Landes erpressen mit der Drohung, die Produktion ins Ausland zu verlagern, gäbe es dort nicht ebenfalls ein entsprechend ausgebildetes Proletariat? Auch deshalb ist Bildung heute zu einer staatlichen Kernaufgabe geworden, sie ist die nationale Produktion der Arbeitskraft für transnational tätiges Kapital. Nötig sind ja nicht nur „ungelernte Handarbeiter“ (die im übrigen auch nicht gänzlich ungebildet sein dürfen), sondern auch Vorarbeiter, Kontrolleure und Supervisoren, technische Experten vor Ort, Planer und Buchhalter. Die internationalen Produktionsketten bedingen, dass sich das Bildungsniveaus eines Teils der Bevölkerung international angleicht.
„Als gebildet mag gelten, wer alles tun kann, was die anderen tun“, glaubt Hegel – mit Wissen entsteht Universalismus; die Menschen werden tendenziell gleichgültig gegen eine besondere Tätigkeit und offen für viele verschiedene. Sehr allgemein gesprochen sind Industrialisierung, Urbanisierung und Bildung natürlich notwendig für die Emanzipation der Menschen. Aber der Prozess ist keineswegs eindeutig. Im kapitalistischen Nullsummenspiel der Globalisierung erzeugt er eine weltweit wachsende Arbeitslosigkeit. Die Bildungskämpfe sind geprägt von der Stellung der jeweiligen Nation auf dem Weltmarkt:
Die Lehrer, Schüler und Studenten bewegen sich vor diesem internationalen Hintergrund. Die Verteilungskämpfen in den Schulen und Hochschulen sind geprägt vom Doppelcharakter der Bildung als Positionsgut und Gemeingut. Über ihr Niveau entscheidet, wie klar und bewusst sich die Protestierenden als (zukünftige) Arbeitskraft begreifen und wie solidarisch sie sich zu den anderen Arbeitenden verhalten. In der fragmentierten Gesellschaft sind die Ausbildungsstätten ein Ort gemeinsamer Erfahrung und der räumlichen Konzentration. Beides sind Voraussetzungen für soziale Bewegungen. Insofern protestieren die Schüler und Studenten auch, weil sie, im Gegensatz zu vielen Arbeitern heute, dazu in der Lage sind.
Die aktuellen Kämpfe zeigen ein widersprüchliches Bild: heftig geführte Verteilungskämpfe und radikale institutionskritische Ansätze, panische absteigende Mittelschichten hier und rücksichtslos aufwärts strebende Mittelschichten dort. Während in fast allen Ländern Bildung eine der zentralen politischen Debatten ist, werden Kapazitäten im tertiären Sektor abgebaut und Schulen kaputtgespart, im Vertrauen, dass die notwendige Arbeitskraft schon von irgendwoher kommen wird. Trotz des Geredes vom internationalen Bildungsmarkt ist die Produktion der Arbeitskraft nach wie vor eine nationale Angelegenheit, die von gesteuerter Migration ergänzt werden soll.
Angesichts dieser verworrenen Lage, liegt es nahe, die Kämpfe im Bildungsbereich wohlwollend zu ignorieren. Wir halten sie dennoch für wichtig und wenden uns gegen einen Utopismus, nachdem sich alles weitere zwanglos „nach der Revolution“ ergeben werde. Jede Gesellschaft muss produzieren, und deshalb muss jede Gesellschaft die dazu nötigen Qualifikationen vermitteln. Dass durch die kapitalistische Entwicklung Wissen massenhaft verbreitet wurde, darf nicht darüber hinweg täuschen, dass es aktiv gepflegt und vor dem Vergessen bewahrt werden muss. Heute wird Wissen produziert in den Bildungsanstalten, den Schulen und Universitäten, aber auch an den Arbeitsplätzen selbst. Dabei war bisher von den Inhalten noch gar nicht die Rede, sondern nur von den sozialen Umständen, in denen sie vermittelt werden – welches Wissen vermittelt wird, ist eine politische Frage. Die Wissenskommunisten gehen über sie souverän hinweg. Die philosophische Höhen erklimmen sie, indem sie allen empirischen Ballast abwerfen.
Mit der Entscheidung, was wir lehren und lernen wollen, legen wir fest, was und wie wir produzieren wollen – es sollten endlich alle Menschen in die Lage versetzt werden, diese Entscheidung zu treffen. Wissensproduktion braucht kostenlos zugängliche Speichermedien und Diskurs. Sie braucht vor allem freie Zeit, auch Zeit, die frei von Existenzangst ist. Insofern kann der Kampf um eine bessere Bildung übergehen in einen für ein gutes Leben.
Literatur
Rudi Schmiede (1992) „Informatisierung, Formalisierung und kapitalistische Produktionsweise. Entstehung der Informationstechnik und Wandel der gesellschaftlichen Arbeit“ In: Thomas Malsch / Ulrich Mill (Hg.): ArBYTE. Modernisierung der Industriesoziologie? Berlin: Edition Sigma. 53 – 86.
Theodor W. Adorno (2002) „Résumé über Kulturindustrie“ In: Gesammelte Werke Band 10 - 1. Frankfurt: Suhrkamp. 337 – 345.
Werner Bätzing / Evelyn Hanzig-Bätzing (2005) Entgrenzte Welten. Die Verdrängung des Menschen durch Globalisierung von Fortschritt und Freiheit. Zürich: Rotpunktverlag.
Andreas Benl (2006) „Empire, die Multitude und die Biopolitik. In: Die Röteln (Hg) Das Leben lebt nicht! Postmoderne Subjektivität und der Drang zur Biopolitik. Berlin: Verbrecher-Verlag.
Manuel Castells (2001) Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Opladen: Leske & Budrich.
André Gorz (2004) Wissen, Wert, Kapital. Zürich: Rotpunktverlag.
Wolfgang Fritz Haug (2003) „>General Intellect< und Massenintellektualität“ In: High-Tech-Kapitalismus. Analysen zu Produktionsweise - Arbeit - Sexualität - Krieg und Hegemonie. Hamburg: Argument-Verlag. 183 - 203.
Max Henninger (2005) „Immaterielle Arbeit, Subjektivität und Territorialität“ In: Grundrisse 15, Sommer 2005.
Ursula Holtgrewe (2001) „Organisationsdilemmata und Kommunikationsarbeit. Call Center als informatisierte Grenzstelle“ In: Ingo Matuschek / Annette Henninger / Frank Kleemann (Hg) Neue Medien im Arbeitsalltag. Empirische Befunde, Gestaltungskonzepte, theoretische Perspektiven. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. 55 - 70.
Paul Thompson (2005) “Foundation and Empire: A Critique of Hardt and Negri“ In: Capital and Class No. 86 / Summer 2005. 99 - 134.
Paolo Virno (2005) Grammatik der Multitude: Untersuchungen zu gegenwärtigen Lebensformen. Berlin: ID Verlag.
Herbert Marcuse (1970) Der eindimensionale Mensch: Studien zur Ideologie der fortschrittlichen Industriegesellschaft. Neuwied: Luchterhand.
Karl Marx (1972) Das Kapital. Erster Band. MEW Bd. 23. Berlin: Dietz.
Antonio Negri / Michael Hardt (2002) Empire. Campus.
Antonio Negri (1996) “Twenty Theses on Marx” In: S. Makdisi / C. Cesarino / R.E. Karl (Hg.): Marxism beyond Marxism. New York.
Franz Nataer (2005) „>Commodification<, Wertgesetz und immaterielle Arbeit“ In: Grundrisse # 14. Wien. 6 – 19.
Maurizio Lazarrato (1998) Verwertung und Kommunikation: Der Zyklus immaterieller Produktion. In: Thomas Atzert (Hg) Umherschweifende Produzenten: Immaterielle Arbeit und Subversion. Berlin: ID Verlag.
Beverly J. Silver (2003) Forces of Labor. Workers’ Movements and Globalization since 1870. CUP.
Alfred Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit, Weinheim 1989.