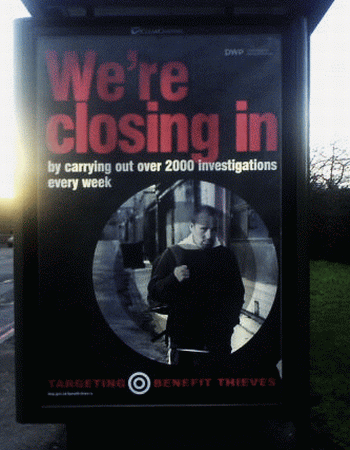
"Die Apathie der Arbeiterklasse"
(Konkret März 2009)
Seit einiger Zeit demonstrieren einige Politiker der Labour Party Volksnähe, indem sie Verständnis für die Sorgen und Nöte der „Arbeiterklasse“ zeigen. Das ist gleich zweifach bemerkenswert: Erstens gehören diejenigen, die sich so äußern, zum wirtschaftsliberalen Flügel der Partei. Zweitens hat die Arbeiterklasse, von der sie reden, eine bestimmte Hautfarbe. „Die weißen Familien finden keine Wohnung für ihre Kinder, aber sie sehen Schwarze und andere Minderheiten einziehen, und sie werden wütend!“ So Margaret Hodge, Parlamentsabgeordnete und einst Ministerin unter Tony Blair über die Verhältnisse in ihrem Wahlkreis. Das Reden über die sogenannte “white working class” ist in Mode gekommen, und angeblich hat die vor allem eine Sorge: zu viele Einwanderer. „Sie haben große Angst vor der Migration“, erklärte Hazel Blears, die Ministerin für Gemeinden und Lokalverwaltung, im Januar, die politische Klasse haben das zu lange ignoriert. Und der Abgeordnete Frank Field legte nach: „Labour sollte besser damit anfangen, etwas zu tun, statt nur darüber zu reden.“ Playing the race card, heißt das in England – die rassistische Karte ausspielen.
Aber auch die Beziehung zwischen Labour und den eingeborenen Arbeiterinnen und Arbeitern ist nicht ungetrübt. Den weißen Prolls fehlt es nämlich angeblich an Ambitionen, an Mobilität und Weltoffenheit. Das berichtete jedenfalls die „Arbeitsgruppe Soziale Ausschluss“. In der "task force" der Regierung diskutieren Vertreter verschiedener Ministerien, wie die soziale Mobilität erhöht und die Armut gesenkt werden könnte. Nun haben sie herausgefunden, dass es der Arbeiterklasse an Ehrgeiz fehlt. Ein zentrales Problem seien mangelnde Ambitionen, besonders unter den männlichen weißen Jugendlichen im Nordosten des Landes.
Laut ihrer Selbstdarstellung fühlt sich die Arbeitsgruppe aus Sozialwissenschaftlern und Behördenvertretern einer „empirisch fundierten Politik“ verpflichtet. In ihrer jüngsten Veröffentlichung „Ambitionen und Leistungen von Jugendlichen aus sozial benachteiligten Gemeinschaften“ stützt sie sich vor allem auf Umfragen. Demnach planen 87 Prozent der 14- und 15-jährigen Briten auch nach ihrem 16. Geburtstag eine Schule oder Ausbildungsstätte zu besuchen. In manchen Gegenden des Landes liegt dieser Anteil aber um bis zu 10 Prozent niedriger. Es handelt sich dabei um sozial benachteiligten Regionen, wo beispielsweise die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist oder es viele Sozialwohnungen gibt.
Es verdichten sich also die Hinweise, zwischen Schullaufbahn und sozialer Herkunft könnte ein Zusammenhang bestehen. Aber, argumentieren die Wissenschaftler im Regierungsauftrag weiter, nicht alle sozial Benachteiligten sind gleich. In manchen extrem armen Bevölkerungsgruppen gibt es strebsame Jugendliche, die „in Bildung investierten“, um sozial aufzusteigen. Obwohl objektiv ebenso benachteiligt, blieben sie signifikant länger auf der Schule. Im nächsten Argumentationsschritt werden die Benachteiligten dann nach ethnischer Herkunft sortiert. Die Bildungsverweigerer stammen angeblich besonders häufig aus der „weißen Arbeiterklasse“. Diese Schicht sei geprägt von „nach außen abgeschotteten sozialen Netzwerken, einer niedrigen Fluktuation und einer Geschichte des wirtschaftlichen Niedergangs“. Andere Gruppen wie die „Industriearbeiter aus Südasien“ und die „großstädtischen Multikulturellen“ seien aufgeschlossener und mobiler. Es ist ein in England weit verbreitetes Klischee: misstrauisch gegen alles Fremde und Neue halten die Proleten stur an ihren überkommenen Gewohnheiten fest und neigen zur kollektiven Depression.
Armut als kulturelles Problem
Im 19. Jahrhundert war Armut nach einhelliger Meinung des Bürgertums ein moralisches Problem. Heute ist sie ein psychologisches und deshalb pädagogisches. „Die Kluft der Ambitionen“ sei der Schlüssel, um die Armut zu bekämpfen, sagte Liam Byrne, der Leiter des Cabinet Offices. Byrne zog auch gleich politische Konsequenzen aus den „Forschungsergebnissen“ – und trieb die Pathologisierung der Armen und Arbeitslosen auf die Spitze. In der Vergangenheit habe der Regierung eine umfassende „kulturelle Strategie“ gegen die Armut gefehlt. Um sie zu bekämpfen, seien Bildungseinrichtungen „von der Wiege bis zur Bahre“ nötig. „Im Mittelalter kreiste das gesellschaftliche Leben um das Gutshaus. Im 19. Jahrhundert kreiste es um die Fabrik, und im 21. Jahrhundert muss es sich um die Schule drehen.“
Byrne regte unter anderem an, bei der anstehenden Reform der öffentlichen Dienste weiterführende Schulen mit Therapie- und Gesundheitseinrichtungen zusammenzulegen: „Es könnte im gleichen Gebäude nicht nur Erziehung für die Kinder und Jugendlichen geben, sondern auch Fortbildungskurse für Erwachsene, weil viele Eltern arbeitslos sind und neue Fähigkeiten brauchen, um wieder in Beschäftigung zu kommen. Es könnte auch eine andere Art von Gesundheitsvorsorge nötig werden, die ebenfalls in den Schulen untergebracht wird, und die sich mehr um die psychische Gesundheit von Kindern und Erwachsenen kümmert.“ Das rechte Boulevardblatt Daily Mail betitelte ihren Bericht über Byrnes Vorstoß am folgenden Tag treffend mit „Labour plant Schul- und Gesundheitsreform gegen die >Apathie der Arbeiterklasse<“.
Ausweitung des Arbeitszwangs
Bereits seit den 1990er Jahren versucht die britische Regierung, Bildung und Gesundheitsversorgung enger zu verzahnen. Bisher ist es allerdings auch wegen des Widerstands der Beschäftigten bei ambitionieren Entwürfen und großartigen Ankündigungen geblieben. Wahrscheinlich wird auch Liam Byrnes Mega-Sozialarbeitszentrum eine technokratische Phantasie bleiben. Seine Verlautbarungen spielen eher eine propagandistische Rolle. Sie reihen sich ein in eine Serie von Diskussions- und Strategiepapieren, mit denen die Bevölkerung auf die anstehende Sozialstaatsreform vorbereitet werden soll. Denn das Sozialleistungssystem soll in diesem Jahr radikal umgestaltet werden.
Das Prinzip der Umstrukturierung lautet „Hilfe zur Arbeit“, wie auch schon bei den vergangenen Reformrunden. Mehr Menschen sollen in Arbeitsverhältnisse kommen und so die Sozialausgaben gesenkt werden. Offiziell sind in Großbritannien eine Million Menschen arbeitslos und erhalten Arbeitslosengeld. Diese Zahl sagt aber über das Ausmaß der Nicht- und Unterbeschäftigung kaum etwas aus. Nicht erfasst werden die geringfügig Beschäftigten, deren Löhne staatlich aufgestockt werden (im Jahr 2005/06 1,8 Millionen Menschen), die Empfänger der Sozialhilfe (2,1 Millionen), darunter viele alleinerziehende Eltern und die Arbeitsunfähigen, die sogenannte Incapacity Benefits (IB) bekommen.
Sie stehen im Zentrum der "Aktivierungsstrategie". Zwischen 1979 und 2004 wuchs die Zahl der wegen chronisch Krankheit oder Behinderung dauerhaft Nicht-Arbeitsfähigen von etwa 800.000 auf 2,6 Millionen. Seit vier Jahren geht sie leicht zurück, hält sich aber auf hohem Niveau. Das mag auch darin liegen, dass das Arbeitsleben in diesem Zeitraum für immer mehr Menschen unerträglich geworden ist. Andererseits aber wurden die IB immer attraktiv, je schwerer der Sozialstaat den Arbeitslosen das Leben machte. Gerade im englischen Nordosten, der besonders unter Deindustrialisierung gelitten hat, dienen die Gelder auch als staatlich finanziertes Auffangprogramm und verdeckte Frühverrentung. 2004 beispielsweise erhielten dort 13 Prozent der erwachsenen Bevölkerung wegen Arbeitsunfähigkeit Sozialleistungen – während die Arbeitslosigkeit offiziell bei drei Prozent stand.
Bei der nun anstehenden Reform lässt es die Regierung unter Gordon Brown nicht an Ambition fehlen. Bis zum Jahr 2010 soll eine Million weniger Menschen die Erwerbsunfähigkeitsrente beziehen, außerdem 3000.000 alleinerziehende Empfänger von Income Support (IS) in Arbeitsverhältnisse gebracht werden. Die Beschäftigungsquote von 75 Prozent soll dadurch auf 80 Prozent steigen – trotz der tiefen Wirtschaftskrise, durch die gerade massenhaft Arbeitsstellen wegfallen.
Zu diesem Zweck werden IB und IS zu einer einzigen Transferleistung zusammengelegt. Die Empfänger – wie bereits erwähnt: chronisch krank oder behindert – müssen künftig regelmäßig nachweisen, dass sie immer noch nicht arbeiten können. In Zielvereinbarungen soll festlegt werden, mit welchen Schritten sie ihre Arbeitsfähigkeit wiederherstellen werden. Die Ämter können die Bezieher „jeder Zeit zu einer Vollzeitbeschäftigung verpflichten, wenn das den Betreuern hilfreich erscheint“, so ein Regierungspapier. Zu diesen Vollzeitbeschäftigungen gehören Arbeitsmaßnahmen nach Art der deutschen „Ein Euro–Jobs“. Nur Eltern mit Kindern unter fünf Jahren und „eindeutig und dauerhaft Arbeitsunfähige“, beispielsweise Schwerbehinderte, bleiben ausgenommen. Für letztere wird eine neue Zahlungsart geschaffen. Mehrere Behindertenverbände haben bereits gegen diese Pläne protestiert.
Nach einer jahrzehntelangen Abfolge von „Sozialreformen“ sind Millionen Briten arbeitslos oder unterbeschäftigt. In der heraufziehenden Wirtschaftskrise berichten die Zeitungen beinahe täglich von Entlassungen und Firmenbankrotte. Die britische Handelskammer schätzt, dass die Zahl der Erwerbslosen bis zum Ende des Jahres auf drei Millionen ansteigen wird. Die schiere Masse der Leistungsempfänger und die unerwartet hohen Verwaltungskosten könnte von den Umerziehungsplänen nichts übriglassen außer hohler Rhetorik.
Aber noch hält die Regierung an ihnen fest und ihre Vertreter gefallen sich in einer Art demagogischen Mitgefühl. Dass die „Sachbearbeiter“ die Bezüge der Arbeitslosen kürzen dürfen, soll selbstredend in deren eigenem wohlverstandenem Interesse sein. Die Strategiepapiere der Regierung Brown tragen Titel wie „Niemand wird abgeschrieben!“ oder „Mit Arbeitsstelle geht es besser!“, und James Prunell, Minister für Arbeit und Renten, sagt: „Arbeit tut den Menschen gut! Die Leute einfach in der Arbeitslosigkeit zu lassen, das wäre grausam.“ Der Workfare-Ansatz, dem die Sozialreformetappe verpflichtet ist, ist beileibe nicht neu oder eine britische Spezialität. Aber noch keine Regierung hat den staatlich organisierten Arbeitszwang so vehement pädagogisch aufgeladen wie die Großbritanniens.