
"Lerne du deinen Kopf in die Erde stecken"
Kann Psychologie einen Beitrag dazu leisten, die Klimakrise zu verstehen? Oder wenigstens, ihren möglichen Fluchtpunkt zu ertragen: das Ende der menschlichen Zivilisation?
Die Angst vor der unwiderruflichen Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen ist nicht neu. Im Verlauf der siebziger Jahre wurde sie zu einem wesentlichen Antrieb der Umweltschutzbewegung. Schon damals nahmen manche Warnungen einen apokalyptischen Tonfall an. Es sei fünf vor zwölf oder vielleicht schon zu spät, hieß es damals. Der Unterschied zur Gegenwart liegt auf der Hand: Bestürzende Bilder der Naturzerstörung gibt es jeden Abend in den Fernsehnachrichten.
Auch wenn sich ihre Folgen je nach Lebensort und Klassenzugehörigkeit erheblich unterscheiden: Die ökologische Krise kommt allmählich im Alltag an. Teilweise sind die Folgen des Klimawandels bereits sichtbar – am Zustand der Wälder beispielsweise oder an den Pegelständen der Flüsse im Sommer –, teilweise sind sie spürbar, etwa wenn Hitzewellen die Innenstädte aufheizen. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sprechen bereits jetzt von einer (statistisch ermittelten)„Übersterblichkeit“ von 13 Millionen Menschen jährlich wegen dieser Veränderungen, die besonders vulnerable Gruppen wie Vorerkrankte, Ältere und Heranwachsende treffen.
Was früher nur in Ansätze erkennbar war und aus wissenschaftlichen Modellen abgeleitet wurde, wird zu einer Erfahrung, die angstvoll in die Zukunft verlängert wird. Wer fürchtet sich jetzt nicht vor Flut, Sturm, Dürre und Feuer? Wen schreckt nicht die Aussicht, dass sie sich häufen werden? Die eigentliche Ursache der Angst ist aber eine andere: Bisher werden keinerlei erfolgversprechende Maßnahmen ergriffen, um die Menge der ausgestoßenen Treibhausgase zu senken (Mitigation) und die Folgen der Erderwärmung durch Anpassungsmaßnahmen abzufedern (Adaption).
Wahrscheinlich war es unvermeidlich, dass sich die Psychologie der Sache annimmt und ihr einen Namen gibt: Eco Anxiety. Der nordamerikanische Dachverband für Psychologie (APA) definiert sie als „chronische Angst vor der Zerstörung der natürlichen Umwelt“. Der australische Umweltphilosoph Glenn Albrecht wiederum spricht von einer „generalisierten Auffassung, dass die ökologischen Grundlagen unserer Existenz zusammenbrechen“. Seit einigen Jahren mehren sich die Publikationen und Forschungsprojekte zur Eco Anxiety, verwandte Themen sind „Ökotrauer“ („Solastalgie“) und gelegentlich auch „Klima-Wut“ (climate anger).
Die Psychologen und Psychiaterinnen unterscheiden dabei zwischen angemessenen Gefühlen und Verhaltensweisen und übertriebenen, krankhaften Reaktionen. Diese Grenze zu bestimmen, ist allerdings durchaus problematisch. Welche Reaktionen sind der Klimakrise angemessen – Suizid, Attentat, Leserbrief? Orgie, Verzicht auf Fortpflanzung, Umsturz? Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Für die existenziellen Fragen, die mit der Klimakrise einhergehen, sind Psychologie und Psychiatrie nicht zuständig und nicht kompetent. Dennoch können ihre Begriffe und Erkenntnisse helfen, die psychische Krise, die aus der ökologischen entsteht, etwas besser zu verstehen.

Beginnen wir mit dem einfachsten und allgemeinsten: Angst macht krank, wenn sie überwältigt, wenn Menschen sich gegenüber drohenden Gefahren hilflos fühlen. Seelische Gesundheit beruht nicht auf dem Vertrauen darauf, dass keine schlimmen Dinge geschehen werden, sondern auf der Erwartung, sie bewältigen zu können, wie vor allem Albert Bandura und Aaron Antonovsky herausgearbeitet haben. Seelische Resilienz gründet auf der Überzeugung, Gefahren zu meistern und kommende Belastungen zu überstehen. Bandura spricht in diesem Zusammenhang von „Selbstwirksamkeitserwartung“ und „Kontrollüberzeugung“, Antonovsky von „Kohärenzsinn“. Wenn sie fehlen, macht anhaltende Angst unweigerlich krank.
Aber worauf kann dieses Vertrauen in Bezug auf die Klimakrise gründen? Wenn wir von der interessanten Ausnahme der sogenannten Prepper absehen, die sich individuell und fatalistisch auf einen gesellschaftlichen Zusammenbruch vorbereiten, muss diese Erwartung auf einer irgendwie gesellschaftlichen, kollektiven Antwort beruhen.
In der Literatur ist in diesem Zusammenhang oft von Hoffnung die Rede. „Sie ist ein essentieller Faktor, um Ängsten vor dem Klimawandel erfolgreich begegnen zu können“, betonen die Psychotherapeuten Bernd Rieken und Paolo Raile. „Fehlende Hoffnung kann sich negativ auswirken und beispielsweise zu Depressionen führen. Wenn eine Person meint, dass ihre Handlungen an der Gesamtsituation nichts ändern, dann könnte es ein Ziel des unterstützenden Umfelds sein, der Person den Glauben an ihre Selbstwirksamkeit zurückzugeben.“
Hoffnungslosigkeit und Isolation sind zweifellos ungesund. Fragwürdig ist allerdings die politische und wirtschaftstheoretische Naivität, die die Literatur zur Eco Anxiety durchzieht. Sie verengt Selbstwirksamkeit entweder auf einen weniger umweltschädlichen Lebensstil oder auf Protestformen, mit denen die Regierungen doch noch zum Umsteuern bewegt werden sollen. Die Macht- und Eigentumsverhältnisse, die der Mitigation und Adaption im Weg stehen, tauchen nicht auf.
Diese Intervention wird umso fragwürdiger, je stärker sie sich selbst als eine Art Gesellschaftstherapie begreift, wie es etwa im Umfeld der Initiative Psychologists for Future der Fall ist. Ihr Ziel sei es, erklären die Autorinnen von Climate Action. Psychologie der Klimakrise, „Handlungshemmnisse zu beseitigen“. Die Hindernisse und Widerstände werden allerdings nur individualpsychologisch gefasst, als Ergebnis von Identitätsproblemen, verzerrter Wahrnehmung und kommunikativer Fallstricke. Politische Prozesse erscheinen als Summe individueller Entscheidungen, die bei einer veränderten Mentalität anders ausfallen würden. Mehr noch, die Individuen sollen durch ihr Engagement das kollektive Versagen sozusagen kompensieren. Reale Machtlosigkeit wird umgedeutet in Fehlinterpretation und Hemmung. Dieser Ansatz wird wissenschaftlich nicht reflektiert, er entsteht aus der therapeutische Praxis. Allerdings mutet er letztlich den von Klimaangst Betroffenen zu, ihre Ohnmacht als Störung zu begreifen.
Sich ohnmächtig zu fühlen, liegt allerdings nahe. Die Klimakrise ist nicht nur global, sie betrifft jeden Lebensaspekt. Treibhausgase entstehen bei jeder Arbeit und bei jedem Konsum. Sämtliche Infrastrukturen dieser Gesellschaft wurden mit fossiler Energie errichtet und werden mit ihr aufrechterhalten. Deswegen lässt sich die Klimakrise nicht mit Kaufentscheidungen entschärfen. Gerade umweltpolitisch Engagierten ist dies häufig bewusst. Ihr Versuch, selbst möglichst wenig zur Erderwärmung beizutragen, speist sich aus dem Wunsch, ein Beispiel zu geben oder wenigstens nicht „mitschuldig“ zu werden.
Die (wenigen) psychologischen Fallstudien zur Eco Anxiety zeigen, dass Schuldgefühle eine große Rolle spielen. Die Betroffenen übernehmen Verantwortung für einen Prozess, den sie nicht wirklich beeinflussen können. Sie verzweifeln an der Verantwortungslosigkeit der Staatenlenkern und Regierungsvertreter. Bei den vermeintlichen Entscheidungsträger handelt es sich aber in Wirklichkeit um „Charaktermasken“ (Karl Marx), die aufgrund ökonomischer und machtpolitischer Zwänge ebenfalls nicht in der Lage sind, das Notwendige zu tun. Dieser Zusammenhang lässt sich intellektuell nachvollziehen, erträglicher wird er dadurch allerdings kaum.
Die Psychologie geht davon aus, dass fehlende Hoffnung das ökologische Engagement schwächt. „Scheitern ist keine Option!“, ist das Motto ihres weltanschaulich motivierten Zweckoptimismus. Der Merkspruch lautet: „It’s real, it’s us, it's bad, there's hope!“ Aber darüber, ob es begründete Hoffnung gibt, kann Naturwissenschaft (allein) nichts aussagen. Dies wird sich in den kommenden Jahren durch die politische Praxis entscheiden. Der individualisierenden Perspektive der Verhaltenspsychologie entgeht, dass Hoffnung nur gesellschaftlich entstehen und gerechtfertigt werden kann.
Die individuellen psychischen Reaktionsweisen auf die Klimakrise können der Klimagerechtigkeitsbewegung dennoch nicht gleichgültig sein. Sie darf das individuelle Leiden weder tabuisieren, noch den Aktivismus selbst als Lösung anbieten. Hoffnung kann nur auf einer wirksamen Praxis gründen kann: individuelle und kollektive Selbstwirksamkeit muss real sein und erfahren werden, sonst ist sie neurotisch. Wohlgemerkt kann eine solche Praxis auch weniger ambitionierte Ziele verfolgen als beispielsweise das 1,5 Grad-Ziel zu retten, wie es Fridays for Future vergeblich versuchte.
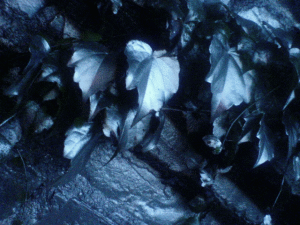
Die alte Parole von der Hoffnung, die angeblich zuletzt stirbt, auf jedem Fall aber noch nicht jetzt, hat eine hässliche Kehrseite. Denn die hegemonialen Teile der politischen und herrschenden Klassen setzen nicht darauf, die faktische Wirklichkeit der ökologischen Krise zu bestreiten. Sie betreiben entweder business as usual oder initiieren Reformen mit der Zielsetzung „grünes Wachstum“, die das Entgleiten des Klimasystems aber kaum abbremsen, geschweige denn verhindern können. Manche Regierungsvertreter, Funktionäre und Experten verleugnen diesen Umstand vor sich selbst. Andere sind sich dessen bewusst und spielen den Glauben nur vor, die Klimakrise lasse sich mit den bisherigen und angekündigten Maßnahmen beherrschen.
Wie immer es um die Motivation der Hauptdarsteller im Staatstheater stehen mag, welche Rationalisierungen oder Selbsttäuschungen bei ihnen zu finden wären, wenn wir sie denn untersuchen könnten – ihr Appell an den Idealismus und Voluntarismus in der Bevölkerung hat etwas Widerwärtiges. Ihre penetranten Versuche, junge Klimaaktivistinnen auf der Weltbühne zu betatschen, sind missbräuchlich. „Gib mich nicht auf, rede mit mir! Ich kann mich ändern. Bitte gib die Hoffnung nicht auf!“, sagen Regierungsvertreter den jungen Menschen, die wegen der Klimakrise zurecht um ihr Lebensglück fürchten.
Eine eindrückliches Beispiel dafür ist die infame Rede, die der ehemalige US-Präsident Barack Obama auf der UN-Klimakonferenz Glasgow im November 2021 hielt. Obama – einer der geschicktesten Polit-Darsteller unserer Zeit – wandte sich direkt an die Jugend: „Ich will, dass ihr wütend bleibt. Ich will, dass ihr frustriert bleibt. Aber kanalisiert diese Wut und zügelt diese Frustration!“ In seiner Amtszeit unterzeichnete Obama die Pariser Klimaverträge und förderte gleichzeitig nach Kräften die Öl- und Gasindustrie seines Landes. Nun mahnte er die Klimaaktivisten zur Geduld, sie sollten sich am politisch Machbaren orientieren: „Macht euch bereit für einen Marathon, nicht für einen Sprint.“
Die gewollte Fixierung auf die „Charaktermasken“, die die „internationalen Klimadiplomatie“ betreiben, ist in vieler Hinsicht ungesund. Weil die Weltgesellschaft sich sozusagen in Geiselhaft der Berufspolitiker zu befinden scheint, richten sich enorme Anstrengungen darauf, sie „wachzurütteln“. Aber bekanntlich können wir niemanden aufwecken, der sich nur schlafend stellt. Im Herbst 2021, nur kurz nach der Weltklimakonferenz, erzwangen junge Klimaaktivistinnen mit einem Hungerstreik (!) ein Gespräch mit dem damaligen Kanzlerkandidaten der SPD. „Olaf Scholz redet mit einer beängstigenden Ruhe über seine Pläne, die unser Land direkt in die Klimakatastrophe führen“, kommentierte eine Teilnehmerin später. „Das macht mir große Angst.“
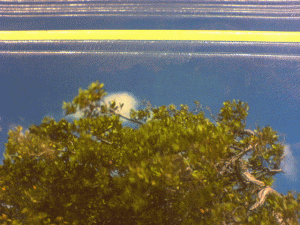
Je mehr Angst eine Botschaft auslöst, umso größer der innere Widerstand. Einige psychologische Untersuchungen deuten darauf hin, dass selbst das ideologisch verfestigte Bestreiten des Klimawandels so motiviert ist: Angst wird empfunden, aber auf andere Erscheinungen verschoben. Die gängige Form der Abwehr besteht allerdings in der formellen Anerkennung der Realität, während ihre emotionale Bedeutung abgespalten wird. Die Erkenntnis wird nicht konkretisiert, nicht auf die eigene Person bezogen. Sie ist „gefühlt bedeutungslos“, wie es die Psychoanalytikerin Delaram Habibi-Kohlen formuliert. Angst und Trauer werden unterdrückt.
Diese nachgiebigere Form der Verleugnung führt in beinah schizophrene Situationen. Schmerzhaft deutlich wird die Spaltung, wenn die unterschiedlichen Ebenen aufeinandertreffen: das formal als objektiv Akzeptierte trifft auf subjektive Erwartungen. Wenn beispielsweise die Zukunft der eigenen Kinder und Enkel vorgestellt wird, wird der gegenwärtige Alltag in die Zukunft verlängert, während gleichzeitig bewusst ist, dass diesem Alltag gerade zahlreiche Grundlagen abhanden kommen. Typischerweise bricht die Imagination in diesem Moment ab. Der mutmaßliche Alltag in einer „Plus 3 Grad Celsius-Welt“ wird gerade nicht vorgestellt.
Menschen, die ihre ökologische Angst und Trauer äußern, verstoßen daher gegen ein Tabu. Die Warnungen vor einer „Klimahysterie“ dienen in erster Linie der Angstabwehr. Diese Kritik beharrt auf einer rein verstandesmäßigen, nüchternen Analyse, führt sie aber charakteristischerweise nie durch: Sie würde zur Beruhigung nicht taugen. Emotionalität wird stigmatisiert, weil Verleugnung der kulturellen Norm entspricht. Der Ernst der Lage lässt sich nur kollektiv wirksam abstreiten. Als beispielsweise vor zwei Jahren öffentlich darüber debattiert wurde, ob Kinder in eine Welt mit so düsteren Aussichten geboren werden sollten, richtete sich die Empörung gegen Frauen, die diese, immerhin naheliegende Frage für sich verneinten.

Wir befinden uns geschichtlich, sogar naturgeschichtlich in einer neuen Situation: Eine einzelne Lebensform treibt das Erdsystem mit seinen großen biochemischen Kreisläufen in einen neuen, instabileren Zustand und führt zum Aussterben zahlreicher weiterer Gattungen. Zwar haben in der Vergangenheit auch andere Gesellschaften ihre natürlichen Lebensgrundlagen durch Raubbau zerstört. Sie taten dies aber (in aller Regel), ohne die kausalen Zusammenhänge zu begreifen. Ihnen stand es außerdem offen, in andere Regionen abzuwandern. Die Rolle der verwissenschaftlichten Arbeit, ihre globale Reichweite und ihr Ausmaß unterscheiden die ökologische Krise des 21. Jahrhunderts von allen vorangegangenen. Mit der steigenden Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre stößt die Menschheit zum ersten Mal an eine planetare Belastungsgrenze.
Damit einher gehen nicht nur psychische Probleme, sondern es stellen sich unbequeme anthropologische Fragen. Die zerstörerische Gewalt von Naturkatastrophen erlebten die Menschen vor der Neuzeit als kontingent. Flut, Sturm, Dürre und Feuer suchten sie heim, ihr Auftreten entzog sich der Kontrolle. Die eigene Machtlosigkeit gegenüber einer unberechenbaren, auch ungerechten Natur war eine gängige Erfahrung. Sie wurde aber niemals nur passiv erlitten. Katastrophen (zu denen übrigens auch Epidemien zählten) wurden praktisch bewältigt und mythisch oder religiös erklärt.
Heute liegen die Dinge anders: Die Fortschritte der Naturbeherrschung haben dazu geführt, dass die Menschen eine umfassende Kontrolle ihrer natürlichen Umwelt erwarten, in gewisser Weise sogar benötigen. Die Naturgewalten schienen weitgehend eingehegt. Nun destabilisieren wir das Klima- und Erdsystem und entfesseln Kräfte, die wir nicht beherrschen können. Gleichzeitig verstehen wir mittlerweile recht gut, was da geschieht. Die Unberechenbarkeit der einzelnen Ereignisse (wie das Auftreten von Stürmen oder die Dauer von Dürren) ändert nichts daran, dass uns ihre Ursachen bekannt ist, die wir dennoch nicht beseitigen können.
Dies entspricht einer tiefen Kränkung. Die Wissenschaft, Grundlage der Naturbeherrschung, belegt gleichzeitig eine offenbar unheilbare Idiotie. Die Gewalt dieser Katastrophe wird nicht technisch erzeugt – sie hat sozusagen eine „natürliche Form“ –, aber wir haben sie verursacht. Es handelt sich um eine „anthropogene Naturkatastrophe“. Insofern kann die Menschheit eigentlich nur an sich selbst verzweifeln. Ein emphatisches Gattungsbewusstsein, das die Moderne seit der Aufklärung prägte und das bis heute niemals gänzlich verschwand, wird unhaltbar.
Dies macht (auch für Marxisten) einen bedeutenden Unterschied. „Der Arbeitsprozess ist zunächst ein Prozess zwischen dem Menschen und der Natur, ein Prozess, worin er seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigne Tat vermittelt, regelt und kontrolliert“, schreibt Karl Marx im Kapital. „Der Mensch tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. … Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur.“ Der materialistische Auffassung zufolge schafft der Mensch durch Arbeit in gewisser Weise sein eigenes Wesen. Nun stellt sich die (das Kapital produzierende) Arbeit unabweisbar als „Zerstörungswerk“ und unsere Fortschritte bei der praktischen Naturbeherrschung als temporär.
Die Klimakrise bedroht den Fortbestand dieser Gattung, das ist die unbequemste aller Wahrheiten. Vernünftig reden lässt sich darüber gar nicht. Was ist natürlich, was kulturell? In der psychischen Verarbeitung der ökologischen Katastrophen verwirren sich die Kategorien. „Natur wird entweder grenzenlos idealisiert als gute und schöne Mutter … oder aber dämonisiert als ‚aus dem Ruder gelaufen‘, ‚zurückschlagend‘“, erklärt Delaram Habibi-Kohlen. Der Klimawandel erscheint als Rache der Natur, die umso schlimmer imaginiert wird, je stärker die eigene Schuld empfunden wird.
Andererseits nehmen viele Menschen Zuflucht in Omnipotenzphantasien. Zu diesem Komplex zählt die Vorstellung, die großen Kreisläufe des Klimasystems ließen sich mit technischen Mitteln regulieren, während der Energie- und Stoffumsatz der Weltgesellschaft weiter wächst. Bei solchen Wunschphantasien handelt es sich um eine Regression hin zum „magischen Denken“, das die Vorstellungswelten der Kindheit prägt: die Stärke eines Wunsches allein verbürgt seine Verwirklichung. Heute bildet dieses magische Denken die Grundlage der staatlichen Klimapolitik.

Dass die Selbstauslöschung unserer Gattung möglich ist, ist eine monströse Tatsache. Diese Wahrheit zu konfrontierten, fällt unsagbar schwer. Sie berührt den empfindlichsten Bereich der Psyche, den Umgang mit der eigenen Sterblichkeit. Wenigstens zu diesem Problem kann die empirische psychologische Forschung etwas beitragen, nämlich in Gestalt der „Terror-Management-Theorie“. „Die Angst vor dem Tod verfolgt das menschliche Wesen stärker als alles andere“, erklärt der Anthropologe Ernest Becker. „Sie ist die Triebfeder der Aktivität – die zu einem großen Teil dazu dient, der Fatalität des Todes auszuweichen, ihn zu überwinden, indem auf irgendeine Art bestritten wird, dass er das endgültige Schicksal des Menschen ist.“
Die wesentlichen Ergebnisse der Terror-Management-Forschung dürfen mittlerweile als gesichert gelten (trotz Skepsis gegenüber den Ergebnissen des psychologischen Wissenschaftsbetriebs ansonsten angebracht ist). Die Details dieser seelischen Dynamik können hier nicht ausgeführt werden. Entscheidend ist, dass Menschen im Bewusstsein des Todes Zuflucht darin suchen, eine tatsächliche oder symbolische Unsterblichkeit zu imaginieren. Dieser „kulturelle Angstpuffer“ lässt sich so formulieren: „Vielleicht muss ich gehen, aber wenigstens ein bisschen bleibt – meine unsterbliche Seele, meine Familie, die Erinnerung an mich, meine Nation, die Gattung …“ Nun bedroht die Klimakrise diesen „Ausweg“. Sie lässt sich mit den etablierten Angstpuffern kaum mildern und begünstigt daher diverse Pathologien. Kurz, um mit der Endlichkeit ihrer Gattung umzugehen, sind Menschen mental und kulturell nicht ausreichend ausgestattet. Es gibt keinen gesunden Umgang mit der ökologischen Krise.
Diese Erkenntnis mag entlasten wirken: Verdrängung und Verzweiflung sind erlaubt. Andererseits kann es manchmal hilfreich sein, den Blick von der Zukunft abzuwenden und in der Gegenwart das Glück zu suchen. Diese Haltung erschöpft sich nicht notwendigerweise in dem Streben nach Genuss hier und heute und sofort, sie führt nicht unbedingt zu dem hektischen Hedonismus, der in Zeiten der Großkatastrophen häufig um sich greift. Vielleicht könnte das Streben nach Glück bedeuten, sich um ein gutes Leben zu bemühen, in dem wir die ökologische Krise weder verleugnen müssen, noch sie zum einzigen Lebensinhalt machen.
Diese Haltung würde dann nicht notwendig auf individualistische Lösungen abzielen (die langfristig ohnehin versagen müssen). Im Gegenteil, sie ist vielleicht sogar eine Grundlage für gesellschaftliches Engagement: Denn nur wer ein lebenswertes Leben wenigstens anstrebt, kämpft entschlossen für dessen Erhaltung. Der US-amerikanische Psychoanalytiker Harold Searles hat schon in den 1970er Jahren beschrieben, wie schädlich eine zwanghafte Zukunftsfixierung sein kann, die die Gegenwart völlig überschattet. Die Dialektik von politischem Engagement und persönlichen Bedürfnissen verdeutlicht er anhand eines persönlichen Erlebnisses: „Als ich kürzlich auf dem Autobahnring von Washington fuhr – etwas schneller als erlaubt, so wie es Brauch ist –, da wurde mir plötzlich bewusst, dass ich mich eigentlich nur beeilte, um von der Autobahn herunterzukommen, um dieses mörderische, trostlose, einsame Gedränge hinter mir zu lassen. Ich fragte mich, ob das auch auf die meisten anderen Fahrer zutraf. Ob dies nicht ein gutes Beispiel dafür ist, wie wir nicht nur die Autobahn, sondern unser ganzes gegenwärtiges Leben empfinden. Zeigt die allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber der Umweltverschmutzung nicht, dass die Qualität des Lebens so wenig befriedigend ist, dass wir reagieren, als sei es nicht wert, darum zu kämpfen?“

Weitere Verhaltenstipps persönlicher und politischer Art lassen sich aus der psychologischen Forschung kaum ableiten. Berührend sind kleine Episoden: Eine ältere Klimawissenschaftlerin erklärt Studierenden, welche Veränderung sie in ihrer Lebenszeit zu erwarten haben, und bricht in Tränen aus. Hilfreich sind banal anmutende Trostworte: „Es wird immer noch gute Tage geben.“ „Du hast getan, was du konntest.“
Ein Gedicht von Bertolt Brecht, geschrieben 1940, erfasst unsere Situation besser als alle theoretischen Erörterungen. Darin heißt es: „Mein junger Sohn fragt mich: Soll ich Mathematik lernen? / Wozu, möchte ich sagen. Daß zwei Stücke Brot mehr ist als eines / Das wirst du auch so merken“ Auf die Fragen des Kindes fallen dem Vater nur zynische Antworten ein. „Mein junger Sohn fragt mich: Soll ich Geschichte lernen? / Wozu, möchte ich sagen. Lerne du deinen Kopf in die Erde stecken / Da wirst du vielleicht übrigbleiben.“ Vor sich sieht er Hunger und Krieg, eine einzige Katastrophe. Selbst die Wissenschaft der Geschichte scheint sinnlos in diesem lichtlosen historischen Moment. Dennoch antwortet er: „Ja, lerne Mathematik, sage ich / Lerne Französisch, lerne Geschichte!“
Brecht hatte die Gabe, unauflösbare Widersprüche dichterisch zu fassen, sodass wir sie wie ein Modell betrachten können. Vielleicht gehorcht der Vater nur der gesellschaftlichen Konvention, vielleicht erspart er dem Kind die Wahrheit aus Mitleid. Dieses Gedicht liefert keine Begründung, aber es gibt die Hoffnung auch nicht preis.