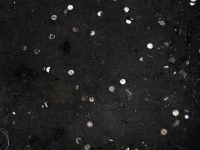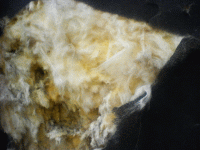Ein Leben ohne Plackerei?
"Späte Digitalisierung" und kapitalistische Krise – Abschaffung oder Verdichtung der Lohnarbeit?
I think that what you're frightened of is knowing you need workers more than they need you.
Robert Wyatt
„Man kann mit ihm reden. ›Nimm diese Schraube und mach sie an einem Auto fest, mit diesem Schraubschlüssel hier.‹ Oder: ›Geh einkaufen und bring mir folgende Lebensmittel mit ...‹ Solche Sachen.“
Mit diesen Worten stellte Elon Musk im August 2021 das neuste Projekt der Firma Tesla vor: einen zweibeinigen Arbeitsroboter, 177 Zentimeter hoch und 57 Kilo schwer. Die Maschine werde für Arbeiten aller Art geeignet sein, erklärte Musk auf dem „Tesla-Tag für Künstliche Intelligenz“ – und das ohne explizite Programmierung. „Körperliche Arbeit wird etwas sein, was wir uns aussuchen können, wenn wir es wollen.“ Bereits 2022 soll ein Prototyp fertig sein. Um das Vorhaben zu veranschaulichen, hatte man einen Tänzer engagiert, der in einem weißen, futuristisch anmutenden Ganzkörperanzug mit Silikonmaske einen Roboter nachahmte, der einen Menschen nachahmt … ein merkwürdiges Schauspiel.
Die Episode ist weniger abseitig, als sie klingt. Sie führt ins Zentrum dessen, was heute Digitalisierung genannt wird, wenn auch auf einem Umweg. Elon Musk verkörpert in der öffentlichen Wahrnehmung den digital-technischen Fortschritt. Laut einer Studie aus Großbritannien aus dem Jahr 2018 wurde er in 12 Prozent aller Medienbeiträge zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) erwähnt. In der Presse gilt er als technologischer Visionär. Seine Projekte wie das Raumfahrtunternehmen SpaceX oder die Starlink-Satelliten stehen für die Front des technisch Machbaren. Er zählt zu den wohlhabendsten und einflussreichsten Menschen der Welt.
Gleichzeitig winden sich Computeringenieure und Robotiker regelmäßig vor Schmerz und Fremdscham, wenn Elon Musk an das Mikrophon tritt. Seine Ankündigungen sind häufig abstrus, zum Teil reine Phantasie. Tesla wird keinen Roboter auf den Markt bringen, der ohne explizite Programmierung Autos repariert oder einkaufen geht. Solche Geräte sind bisher einfach nicht machbar. Dass die Ankündigung völlig unrealistisch ist, schadet aber Tesla und insbesondere Musk nicht im geringsten.
Gerade deshalb taugt Elon Musk als Gesicht der „späten Digitalisierung“, in der sich Phantasie und Realität auf besondere Weise mischen. Der Ausdruck steht hier sowohl für ein Bündel von Technologien als auch für eine Ideologie, das heißt: für Basis und Überbau. Verbunden ist die so verstandene Digitalisierung mit dem Aufstieg von Firmen wie Tesla.
Meine These lautet, dass diese Entwicklung erst verständlich wird als Ausdruck einer makroökonomischen Krise. Diese Krise ist gekennzeichnet durch eine stockende Rationalisierung der Arbeit, industrielle Überkapazitäten und ökonomische Stagnationstendenzen (besonders, aber nicht nur) in den frühindustrialisierten Ländern. Erst dieses Umfeld erlaubt einem Unternehmer wie Elon Musk, seine besondere Rolle zu spielen. Aber Tesla weckt nicht nur Phantasien, sondern bewegt enorme Investitionen. Wer Elon Musk lächerlich findet, spricht gleichzeitig ein Urteil über unsere Zeit, die ihn hofiert. Er ist sozusagen eine Mischung aus John Pierpont Morgan und Charles Ponzi, ein Industrieller und ein Hochstapler, und solche merkwürdigen, diffusen Mischungen charakterisieren die späte Digitalisierung.
Finanzialisierung und Digitalisierung
Die Medien lieben Elon Musk, weil er niemals langweilig ist. Er spricht über Daten-Schnittstellen zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern, über automatisierten Individualverkehr, die baldige Besiedlung des Planeten Mars oder eine drohende Machtübernahme von denkenden Maschinen. Dass man ebenso gut, vielleicht besser die Frau von der Käsetheke im Supermarkt nach ihrer technischen Expertise fragen könnte, stört überhaupt nicht. Das Phänomen Elon Musk beruht gerade darauf, dass niemand ihn ernst nehmen muss, damit er Trends setzt.Im Januar 2021 beispielsweise schrieb Musk bei dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Benutzt Signal!“ Damit meinte er den gleichnamigen Internet-Messenger. Dennoch stieg der Aktienkurs der US-amerikanischen Firma Signal Advance, ein Hersteller von Medizintechnik, innerhalb weniger Stunden von 0,60 US-Dollar auf zeitweise 70 US-Dollar. Professionelle Börsenhändler nennen Freizeit-Spekulanten manchmal respektlos „dummes Geld“, Investitionen ohne Strategie, Sinn und Verstand. Aber es ist nicht dumm, aufgrund eines Tweets von Elon Musk Aktien zu kaufen und auf steigende Kurse zu wetten, wenn davon auszugehen ist, dass genug Menschen ihn falsch verstehen werden. Ja, selbst wenn niemand ihn falsch versteht, kann eine solche Wette rational sein, sofern die Zeitspanne bis zur Veräußerung kurz genug ist. Von diesem merkwürdigen Umstand abgesehen illustriert die Anekdote, wie viel Kapital nach profitablen Anlagemöglichkeiten sucht.
Computertechnik, Internet und KI entstanden als staatlich geförderte Großtechnik. Ihre massenhafte Verbreitung im Alltagsleben ab den 1980er Jahren war dann allerdings eng mit den Finanzmärkten verbunden. Einerseits investierten Börsen und Finanzinstitutionen in die neuste und schnellste Computer- und Kommunikationstechnik, um ihre Transaktionen zu beschleunigen (und zu diesem Zweck zu automatisieren). Andererseits lieferten die entsprechenden Technologien ein plausibles Narrativ für die Aktienspekulation und befeuerten so die Expansion der Finanzmärkte, insbesondere seit der sogenannten dot.com-Blase Ende der 1990er Jahre. Klappern und Plappern gehört zu diesem Geschäft notwendig dazu.
Dies ist der Hintergrund von Elon Musks Karriere. 1999 kaufte er ein Unternehmen, das Zahlungen übers Internet abwickelte. In der Folgezeit wurde er reich durch Unternehmensübernahmen und Aktienoptionen. Laut dem US-Magazin Forbes erhielt er im Jahr 2020 elf Milliarden US-Dollar in Form von Aktien der Firma Tesla, wo er als Vorstandsvorsitzender fungiert. Allerdings erzielte der Autohersteller im Zeitraum zwischen der Gründung im Jahr 2003 und dem Jahr 2020 keinen Gewinn. Immerhin konnte das Unternehmen die Menge der verkauften hochpreisigen Elektrofahrzeuge zwischen 2016 und 2020 von 76 000 auf 499 000 Stück steigern. Zum Vergleich: der Volkswagen-Konzern verkaufte 2020 9,3 Millionen Autos – also die 18-fache Stückzahl –, seine Marktkapitalisierung lag dennoch deutlich unter der von Tesla. Zeitweise war VW nur ein Sechstel von Musks Firma wert.
Die Digitalkonzerne als Krisenprofiteure
Die treibende und bestimmende Rolle des Finanzkapitals bedeutet nicht, dass es sich bei der späten Digitalisierung um „reine Spekulation“, Hirngespinste und Bauernfängerei handelt. Im Gegenteil, seine Rolle besteht schließlich darin, innovative Produkte und Verfahren zu identifizieren, von denen ein Produktivitätssprung zu erwarten ist, weil sie den etablierten unternehmerischen und technischen Strukturen überlegen sind. Allerdings hat die Informations- und Netzwerktechnik dieses Versprechen auf wachsende Produktivität bisher kaum eingelöst.Während digitale Technik und Daten verarbeitende Geräte sich immer weiter verbreiten, gehen die Zuwächse bei der Arbeitsproduktivität seit den 1960er Jahren langfristig zurück. Mitte der 1990er Jahre stiegen die Zuwächse in den USA allerdings von etwa 1 Prozent auf 2,3 Prozent jährlich. Diese Steigerung beruhte aber fast ausschließlich auf Rationalisierungserfolgen im Groß- und Einzelhandel. „Seit 2005 ist die Produktivitätszunahme schon wieder zu Ende“, betont Peter Brödner. „Seitdem liegt sie zunächst bei einem Prozent und ist zuletzt trotz weiterer Investitionen in Computertechnik sogar deutlich unter diesen Wert gefallen.“
Der Einfluss von Computertechnik auf die Produktivität ist diffus. Trotzdem sind Unternehmen, deren Geschäft auf die ein oder andere Weise auf Digitaltechnik und Internet beruht, mittlerweile die wertvollsten der Welt, zumindest gemessen an der Marktkapitalisierung. Unter den ersten Zehn finden sich Microsoft, Apple, Alphabet / Google, Facebook, Amazon, Alibaba und Tencent. Während die „Leitindustrien“ früherer Epochen Basisinnovationen verbreiteten, durch die die Produktivität gesamtgesellschaftlich wuchs (wie zum Beispiel Elektrizität, Farben- und Elektrochemie, motorisierter Individualverkehr oder Haushaltsgeräte), sind diese Technologiekonzerne keine Wachstumstreiber. Sie scheinen von den Tendenzen der ökonomischen Stagnation geradezu zu profitieren – wie kann das sein?
Ein Versandhändler wie Amazon unterscheidet sich natürlich grundlegend von einem Medien- und Werbekonzern wie Google oder einer Software- und Computerfirma wie Microsoft oder Apple. Gemeinsam ist ihnen, dass sie bestimmte Marktnischen fast vollständig beherrschen und Monopolgewinne erzielen, weil sie Kunden und Zulieferer erfolgreich an sich binden. Wenn möglich treten diese Unternehmen nur als Vermittler auf und verlangen von Anbietern und / oder Konsumenten Gebühren. Mit dieser „Plattformstrategie“ lagern sie unternehmerische Risiken aus: Wie immer die Transaktion auch aussehen mag, der Vermittler verdient immer an ihr. Die Soziologin Sabine Pfeiffer spricht in diesem Zusammenhang vom Digitalen als einer „Distributivkraft“: „Im entwickelten Kapitalismus unserer Tage ist das zentrale Problem die Realisierung von geschaffenen Werten auf Märkten. Strategien der Marktausdehnung und des Konsums werden zum relevanter werdenden Feld für Konkurrenz.“ Diese Strategien tragen allerdings nicht zum gesamtgesellschaftlichen Produktivitätswachstum bei, sondern schaffen lediglich „proprietäre Märkte“ (Philipp Staab), auf denen die Plattformen „Informationsrenten“ (Ralf Krämer) abschöpfen.
Die Orientierung auf Renten, verbunden mit einer schwachen Nachfrage für Konsum- und Investitionsgüter, ist ein Aspekt der säkularen Stagnation in den frühindustrialisierten Länder. Insofern umfasst die „späte Digitalisierung“ „neo-feudalistische“ Tendenzen: „Für etwas Geld zu verlangen, dessen Produktion einen nichts gekostet hat, entspricht eigentlich nicht kapitalistischen Umgangsformen. Renten sind, salopp gesagt, typisch feudalistisch. Aber die Plattformen tun nichts anderes wie einst die Landesherren, wenn sie den Zehnten verlangen für den Zugang zu einem Markt, um den sie einen Zaun errichtet haben.“ Allerdings verlangen sie nicht den Zehnten, sondern „den Dritten“. Die Vermittlungsgebühren in den „App-Stores“ von Apple, Android oder Amazon liegen oft bei 30 Prozent.
Die marktbeherrschende Stellung dieser Konzerne bleibt allerdings permanent umstritten. Informationsrenten beruhen auf bestimmten ökonomischen und sozialen Voraussetzungen, zum Beispiel auf der wirksamen Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten (Patente, Urheberrecht) und auf technischen Maßnahmen, um den Datenfluss zu kontrollieren. Zudem bleibt ein Markteintritt von Konkurrenten prinzipiell weiterhin möglich. Es handelt sich um „volatile Monopole“ (Ulrich Dolata). Dies gilt insbesondere für reine „Internetunternehmen“, die digitalisierbare Waren verbreiten, wie Suchmaschinen, Soziale Netzwerke und Medienhändler (etwa Streamig-Anbieter). Diese Unternehmen sind „schlank“ insofern, als dass ihr Geschäft fast ausschließlich auf Software beruht und sie kaum über Produktionskapital verfügen (im Gegensatz beispielsweise zu einem Logistiker wie Amazon). Gerade deshalb sind sie ersetzbar, denn Kunden und Zuarbeiter können mühelos zu einer anderen Plattform weiterziehen.
Aus diesem Grund müssen die Plattformen Zulieferer und Kunden an sich binden (Lock-in-Strategien), zum Beispiel indem sie die generierten Daten monopolisieren. Ab einer gewissen Größe wirken Netzwerkeffekte einem Wechsel entgegen: „Ein Unternehmen kann heute nicht mehr existieren, ohne auf Google gefunden zu werden; Software, die nicht über Google Play oder den Apple App Store angeboten wird, ist zunehmend irrelevant, und die Listung auf Plattformen wie Amazon und Alibaba versetzt viele Anbieter erst in die Lage, überhaupt die Möglichkeiten des Onlinehandels nutzen zu können.“ Außerdem verteidigen sich die Plattformen, indem sie potentielle Konkurrenten aufkaufen und deren Systeme ihrem eigenen Angebot hinzufügen.
In einer wirtschaftshistorischen Perspektive zeigt sich, dass der Aufstieg großer, teils transnationaler Handelskonzerne bereits vor der Verbreitung von Digitaltechnik begann. Die „Rationalisierung des Konsums“ durch die Selbstbedienung der Kunden, Discount-Strategien und eine ausgefeilte Logistik zieht sich durch das ganze 20. Jahrhundert. Die Möglichkeiten durch Vernetzung und Verdatung (etwa maschinenlesbare Barcodes) beschleunigten ab den 1980er Jahren diese Entwicklungen und stärkten große Einheiten am Ende der Lieferkette gegenüber den Zulieferern.
Die gegenwärtige relative Stärke des („digitalen“) Handelskapitals erklärt sich wiederum aus dem Nachlassen der wirtschaftlichen Wachstumsdynamik. Die Online-Händler sind am besten in der Lage, kaufkräftige Nachfrage aufzuspüren. Sie sind ganz nah beim Kunden – auf seinem digitalen Endgerät in der Jackentasche. Sie wissen (angeblich) am besten, was er will. Sie machen ihm als erste ein Angebot und versprechen gleichzeitig, dass es nirgendwo billiger zu haben ist. Über den Erfolg entscheiden der günstigste Preis, eine breite Angebotspalette und das Tempo der Transaktion (on demand). So versuchen die Plattformen, den letzten, entscheidenden Schritt in der Wertschöpfungskette zu kontrollieren, den Verkauf an den Endkunden. Gleichzeitig setzen sie ihre Lieferanten unter Druck und treiben einen Unterbietungswettbewerb an.
„Gig-Economy“: computergestützte Tagelöhnerei
Der Beitrag der Internet-Plattformen zur gesamtgesellschaftlichen Produktivität mag fragwürdig sein, immerhin sind sie selbst profitabel. In der zweiten und dritten Reihe dagegen finden wir sogenannte App-Konzerne wie Uber oder Wolt (die Branche wird auch auch Gig Economy, früher Sharing Economy genannt), die keine oder nur geringe Gewinne erwirtschaften. Sie leben bisher von der fortgesetzten Finanzierungsbereitschaft der Investoren. Fast alle von ihnen setzen auf Expansion um jeden Preis. Das Kalkül: Wenn ein Marktsegment erst einmal erobert ist, können die Preise für Endkunden und Lieferanten steigen. Dass diese Strategie teilweise über Jahre durchgehalten wird, ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass es an attraktiven Investitionsmöglichkeiten mangelt, worauf beispielsweise Florian Butollo und Patricia de Paiva Lareio hinweisen: „Ein Exzess an Anlagekapital steht einer relative Stagnation auf der Nachfrageseite gegenüber und entsprechend dominieren Anlagestrategien, die auf Marktdominanz wetten.“Anders gesagt, die App-Unternehmen wollen gerne zu marktbeherrschenden Plattformen werden. Im Gegensatz zu „Online-Marktplätzen“ und „Match-Makers“ können sie sich allerdings nicht auf eine bloß formelle Vermittlung beschränken. Typischerweise organisieren sie einfache Dienstleistungen wie Lieferungen und Personentransport, dies vor allem in großen Städten. Ihren Beschäftigten zahlen sie meist den Mindestlohn oder nur wenig mehr. Teilweise müssen die Angestellten trotzdem ihre Ausrüstung oder beispielsweise Fahrradreparaturen selbst bezahlen. Eine wesentliche Innovation der App-Unternehmen besteht nämlich darin, die Ressourcen der Beschäftigten als Kapital einzusetzen. Mit den Möglichkeiten des mobilen Internets organisieren sie ein System der Tagelöhnerei, das flexiblen Personaleinsatz mit niedrigen Arbeitskosten verbindet.
Der langfristige Erfolg dieses Geschäftsmodells ist nicht gesichert. Er beruht unter anderem darauf, dass die Aufsichtsbehörden die gewagte arbeitsrechtliche Konstruktion akzeptieren, derzufolge die Mitarbeiter selbständig tätig seien, und die Gewerbeaufsicht wohlwollendes Desinteresse zeigt. Die App-Konzerne brauchen einen permanenten Nachschub unverbrauchter Mitarbeiter; in einigen Fällen werden jedes Jahr 90 Prozent der Belegschaft ausgetauscht. Auf den ersten Blick wirkt Gegenwehr der Beschäftigten fast unmöglich. Es handelt sich zu einem großen Teil um junge Migranten ohne (sichtbare) Machtressourcen. Für viele ist der Job nur ein Zuverdienst, entsprechend gering ist ihre Bereitschaft, sich für bessere Löhne oder Arbeitsbedingungen zu engagieren. Verträge unliebsamer Mitarbeiterinnen werden nicht verlängert. Dennoch kam es bei vielen Lieferdiensten zu Protesten gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und vereinzelt zu Betriebsratsgründungen. Wenn das Management in die Gewinnzone will, müssen die Löhne allerdings sinken.
Rationalisierung auf Daten-Grundlage
Solche neuen Märkte und Unternehmensformen sind die eine Seite der „späten Digitalisierung“ – eine „Internetwirtschaft“ geprägt durch einen Überschuss an liquidem Kapital, fehlender Kaufkraft und Unterbeschäftigung. Davon zu unterscheiden ist die „Digitalisierung“ der konkreten Arbeit in den bestehenden Unternehmen, konkret: die Rationalisierung auf dem gegenwärtigen Stand der technischen Möglichkeiten.Wenn Tesla einen Universal-Roboter ankündigt, versinnbildlicht dieser Apparat eine gelingende Rationalisierung und eine deutlich steigende Produktivität – mithin genau das, woran es dem System gegenwärtig fehlt. Aber bei der gegenwärtigen Rationalisierung spielen Roboter – ob nun von Tesla oder von anderen Herstellern – keine wichtige Rolle. Die Unternehmen investieren insgesamt kaum in neue Automatisierungstechnik, nicht zuletzt deshalb, weil die stagnierenden Löhne solche Investitionen überflüssig beziehungsweise riskant machen.
Im Herbst 2021 scheinen die Arbeitskosten (auch in Gestalt von „Personalmangel“) endlich zu steigen, damit auch der Anreiz für die Automatisierung. Ob dieser Trend anhalten wird, ist unklar. Bisher jedenfalls setzt das Management in der Regel nicht auf Roboter, sondern auf eine Abwertung der (Fach-)Arbeit mit digitaltechnischen Mitteln.
Simon Schaupp betont in diesem Zusammenhang die Rolle der „algorithmischen Arbeitssteuerung“, die er folgendermaßen charakterisiert: „Arbeitsanweisungen werden von Computern erteilt. Das Arbeitshandeln wird digital evaluiert. Die erhobenen Daten werden genutzt, um menschliche Arbeit aus den betreffenden Produktionsprozessen zu verdrängen.“ Die algorithmische Steuerung automatisiert weniger bestimmte Teilarbeiten als vielmehr (tendenziell) das Management. Planung, Disposition, Beurteilung und Kontrolle der Arbeit finden zunehmend Software-gestützt statt. Die Tätigkeiten werden medial und kleinteilig angeleitet, zum Beispiel mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung auf einem digitalen Endgerät. Um es etwas zugespitzt zu formulieren, die algorithmische Steuerung zielt nicht darauf ab, die Menschen durch Roboter zu ersetzen. Sie will die Menschen in Roboter verwandeln.
Diese Unterscheidung ist wichtig. In der betrieblichen Praxis sind „Automatisierung“ (das heißt: Mechanisierung) und „Digitalisierung“ (das heißt: Erfassung und Steuerung der Abläufe mit Computer-Software) zwei unterschiedliche Ansätze der Rationalisierung, zwischen denen sich das Management entscheiden muss. Die Umorganisation der betrieblichen Abläufe auf digitaler Grundlage hat sich in der Logistik, bei manchen personenbezogenen Dienstleistungen und in der Gig Economy verbreitet. Die „algorithmische Steuerung“ dringt aber auch in die industriellen Fertigung vor und führt im Ergebnis oftmals zu einer Dequalifizierung. Diese Entwicklung widerlegt die Hoffnungen, die DGB und IG Metall an das Projekt „Industrie 4.0“ knüpften. Diese Initiative zielte auf eine Modernisierung der deutschen Industrie, um ihre Position gegenüber den USA und China zu verbessern. Die Gewerkschaften verbanden damit den Wunsch, in den Kernbereichen der deutschen Exportindustrie – Maschinenbau und Automobilherstellung, nach Möglichkeit auch Elektronik, Pharma- und Chemieindustrie – die Betriebe auf eine „high road“ zu bugsieren, wie das industriesoziologische Schlagwort lautet: Steigerung der Produktivität durch Investitionen in qualifizierte Beschäftigte und Technik. Diese Aufwertung sollte mittels einer staatlich finanzierten und moderierten technologischen Offensive erreicht werden und nicht zuletzt Verlagerungen ins Ausland entgegenwirken.
Allerdings hat die umfassende Vernetzung von Maschinerie und Beschäftigten und die automatisierte Datenauswertung (sofern sich die Unternehmen darauf eingelassen haben) die Prozesse nicht nennenswert effizienter gemacht, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Die erhoffte Produktivitätssteigerung blieb aus, die Modernisierung der technischen Ausstattung stockt weiterhin. Was immer das Problem der Unternehmen sein mag, ein Mangel an Daten ist es offenbar nicht. Die „Industrie 4.0“ fokussierte ganz auf die Digitaltechnik. Fragen der betrieblichen Organisation, der Arbeitsteilung und Hierarchie tauchten dagegen nicht auf, ebenso wenig der fundamentale Widerspruch, dass die Beschäftigten komplexere Prozesse beherrschen sollen, während sie gleichzeitig (relative) Einbußen bei Entlohnung, Arbeitsbedingungen und beruflicher Autonomie hinnehmen müssen.
Eine neo-tayloristische Unternehmensberatung behauptet unterdessen, betrieblicher Erfolg sei möglich, indem die Beschäftigten lückenlos überwacht und überlistet werden. Arbeiter aus der Automobilindustrie berichten, dass der Zugang zu Maschinen (und damit zu Daten) mit kleinen verschiedenfarbigen Metallschlüsseln geregelt wird. Diese Schlüssel würden von Kollegen nur ungern weitergeben, weil sie immer wieder benötigt werden. „Ne, da leiht keiner gern seinen Schlüssel aus!“, erzählt mir ein junger Mann. So lenkt das Management den Zugriff – und damit die betriebliche Hierarchie – wirksamer als beispielsweise mit Passwörtern, die mühelos weitergegeben werden können – und verhindert aus Angst vor einem Kontrollverlust Kooperation.
Die Leerstelle
Kehren wir abschließend noch einmal zu dem Roboter von Tesla zurück, der vielleicht irgendwann tatsächlich auf den Markt kommen wird. Der automatische Diener und die denkende Maschine faszinieren die Menschen schon seit Jahrhunderten. Sie wecken Ängste vor Abwertung und Arbeitslosigkeit, aber auch Hoffnungen auf ein Leben ohne Plackerei, vielleicht sogar auf eine Welt ohne Lohnarbeit. Leider überstrahlt diese Faszination die wirkliche Rolle von Robotik und Maschinenlernen in der Produktion als Werkzeugen.Denn was für die gewerkschaftliche Debatte über die „Industrie 4.0“ gilt, gilt ebenso für die öffentliche Auseinandersetzung über die Digitalisierung. Die lebendige Arbeit taucht höchstens am Rande auf, als bemitleidenswert und schutzbedürftig, von denkenden Maschinen bedroht. Dabei entscheidet die Arbeit – mit ihren Kenntnissen und Fertigkeiten, ihren Wünschen und Bedürfnissen – nach wie vor über Erfolg oder Misserfolg Produktion.
Viele Arbeiten, übrigens gerade auch einige im Niedriglohnbereich, sind durchaus schwierig durchzuführen, und die Beschäftigten müssen nicht nur leidensfähig, sondern auch lernfähig und sozial kompetent sein. Trotz der Digitalisierung, manchmal gerade wegen ihr bleiben die besonderen Fähigkeiten der lebendigen Arbeit – Vernunft, Verstand und Kommunikation – entscheidend. Dieser Umstand wird immer wieder übersehen, ausgeblendet und abgestritten. Der Maschinerie dagegen werden wahre Zauberkräfte zugeschrieben. Die diskursive Abwertung der lebendigen Arbeit findet ihre Fortsetzung in ihrer praktischen Abwertung.
Dieser Text erschien im Mai 2022 in dem Band 'Fortschritt in neuen Farben? Umbrüche, Machtverschiebungen und ungelöste Krisen der Gegenwart', herausgegeben von Frank Deppe Georg Fülberth und André Leisewitz bei Papyrossa (Köln).