Mein prekärer Arbeitsalltag
Wie viele Schläge steckst du ein, bis du zu Boden gehst? Schließlich bist du kein Boxer, dein letzter Faustkampf zehn Jahre her. Und wenn du dann liegst, ganz, ganz waagrecht, was machst du dann? Was passiert jetzt?
- Na, da ist offenbar einiges schief gelaufen, sowohl pränatal als auch postnatal.
Trotz aller Härte und selbstauferlegter sogenannter Konsequenz, es herrschte in den Kreisen und Ecken, in denen ich verkehrte, immer ein Gefühl von "Nur so tun als ob", ein "So schlimm wird es schon nicht kommen". Da war etwas Spielerisches.
- Diese Versammlung ist verboten. Lösen Sie sich auf.
Genau so lautete die höfliche Stilblüte des Einsatzleiters, gefolgt von den atemlos aufeinander folgenden drei Warnungen. Mein Erschrecken, als die Reihe der Behelmten plötzlich aufbrach und die Beamten auf uns zuliefen, die Knüppel schlugen unterschiedslos und eifrig ein auf alles; der Kinderwagen einer Passantin wurde umgestoßen; sie schrie und fiel selbst zu Boden.
Das ist jetzt zwölf Jahre her. Heute erinnert mich das auch an Eisensteins berühmte Treppenszene aus "Panzerkreuzer Potemkin", damals dachte ich gar nicht, sondern rannte. Das Gefühl "Als ob" bekam einen ersten Riss. Es lässt sich wahrscheinlich nur durch ein ganz unangebrachtes Urvertrauen erklären, mitgegeben aus bürgerlichen Elternhäusern, in meinem Fall: erworben in der mütterlichen Wohnung, kleine Bürger, Möchtegernbürger, nie mehr losgeworden.

Auf die Straße. Hopfengestank von der großen Brauerei, heftiger, diagonaler Regen. Es drängen sich mir verhängnisvolle Gedanken auf, Gedanken an ein Verhängnis. Die schwarzen Schuhe mit dem Stück Metall in der Sohle, die ich in London gefunden habe, haben Löcher.
Ich fahre mit der S–Bahn nach Altona, ohne Fahrkarte, will zur Bücherei. Die gefundenen Schuhe sind nicht nur undicht, sondern lärmen auch bei jedem Schritt. It’s not easy being a homeless Mod. Ich bücke mich unter den Raubtauben in der Fußgängerzone weg. In die Bücherei, dort sind viele Beschäftigungslose wie ich, meist ältere bärtige Männer, die mit herzzerreißender Gründlichkeit die Tageszeitungen studieren. Sie lesen den Wirtschaftsteil und die Politikseiten, niemals das Feuilleton. Sie wollen Information. Was fangen sie damit an? Für solche Bewohner ist die öffentliche Sphäre nicht vorgesehen. Wie die obdachlosen Radiohörer, die zwar keine Gebühren zahlen, aber ihre Einsamkeit mit lebenden Stimmen bekämpfen, und lebende Stimmen gibt es nun mal vor allem in den Bildungsbürgerprogrammen.
Greife ein Buch, aber kann mich nicht konzentrieren. Einen Tisch weiter sitzt ein großer, schwerer Mann mit einem Stapel Comics vor sich. Seine Kleidung ist ganz schwarz, er trägt Silberschmuck und einen dünnen Schnauzbart. Ich verstehe, ein arbeitsloser Satanist. Schnell blättert er ein Comic nach dem anderen durch. In fünf Minuten ist er mit einem Heft fertig, vielleicht schaut er sich auch nur die Bilder an. So frisst er eine Erzählung nach der anderen in sich hinein, ohne zu verdauen, nur um ein Flimmern vor den Augen zu erzeugen, das die Langeweile kurzfristig bekämpft. Manchmal rundet sich sein Schnurrbart langsam, dann hat er etwas Lustiges entdeckt.
Eine weitere Schwarzfahrt zur Universität. Ich muss aufpassen, um diese Zeit gibt es viele Kontrollen. In der großen Bibliothek an der Universität kann ich ins Internet. Obwohl die frei zugänglichen Computer dafür nicht vorgesehen sind, scheint jeder die Tricks zu kennen, die Zugangssperre zu umgehen. Hier sitzen geschäftige und strebsame Studenten, manche schon in Anzug und Krawatte, ihrer zukünftigen Arbeitskleidung. Aber wenn ich mich genau umsehe, mit dem Blick des Medienproleten, entdecke ich zwischen ihnen andere, die nicht hierher zu gehören scheinen. Da ist ein fettleibiger Mann, der ein Spiel im Internet spielt. Da ist eine offensichtlich psychotische junge Frau, die sich hektisch durch die Seiten klickt. Wir kennen uns nicht.

Was fange ich mit diesem Tag an? Was mit dem Rest meines Lebens als Medienprolet? Die Auftragslage ist schlecht, to say the least. Gestern habe einen Redakteur angerufen, der mir sagte, er könne meinen Artikel nicht kaufen, sein Ressort habe eine Ausgabensperre bis zum Jahresende. Auch was danach sein wird, weiß er nicht. Soll ich den Artikel ohne Bezahlung schreiben, in der üblichen abgeschmackten Hoffnung, so "einen Fuß in die Tür zu bekommen", was sich später möglicherweise unter anderen Umständen auszahlen könnte? Die Preise drücken? Ich lasse es sein, aus Trägheit oder aus Prinzipientreue.
Es bleiben Sparsamkeit und Improvisation. Ich hatte merkwürdige Arbeitsplätze: das Internetcafé im Norden Indiens, in dem ich rüde aufgefordert wurde, meine Schuhe auszuziehen. Der kostenlose Zugang in der Eingangshalle eines Krankenhauses in Innsbruck, wo ich in einer Nacht einen Artikel über einen französischen Fußballstar verfasste. Die Computer in der Bücherei in Ost–London, halbstündig vorgemerkt. Die Bibliothek in Hamburg, auf Umwegen kommt man ja schließlich doch überall hin im Netz. Internetcafés der verschiedensten Art, zwischen indischen Yuppies, amerikanischen Touristen, türkischen und englischen Proleten. Ein pakistanischer Junge erklärt seinem Vater, der neben ihm sitzt, wie man eine Email abruft.
Irgendwann während des Studiums merkte ich, dass mit journalistischen Texten etwas Geld zu verdienen war, und ich begann, gelegentlich für Zeitungen zu schreiben. Diese Arbeit kam meinem Hang zum Einzelgängertum entgegen, verlangte aber andererseits bestimmte kommunikative Fähigkeiten, von denen ich eigentlich gedacht hatte, sie fehlten mir gänzlich. Nach wie vor hasse ich am meisten, mit den Redakteuren zu verhandeln, das Anbieten und Verkaufen.
Ich glaube an das Menschenrecht auf den täglichen Besuch im Café. Wie es sich für einen gehört, der irgendwie ein homme de lettres ist, nur will seine Worte niemand kaufen. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Hier gibt es Gesellschaft, die weder fordert, noch gibt, aber die Einsamkeit vertreibt. Hier gibt es Zeitungen und Zeitschriften und seit einigen Jahren auch manchmal einen Netzzugang. Zu Werbezwecken hat AOL einige kostenlose Terminals in großstädtischen Cafés aufstellen lassen – nur leider in solchen, die einerseits modisch, andererseits etwas teurer sind. AOL geht es um den "Imagetransfer", ein Produkt drängt sich ganz eng an ein anderes Produkt, weil dieses dem Kunden gefällt. Das weiß ich, weil ich studiert habe. Ansonsten war mein Studium ein Verlustgeschäft.
Im Café ins Netz zu gehen bedeutet: das Geld für ein Internetcafé zu sparen, andererseits einen überteuerten Kaffee zu bezahlen und dann unter Umständen noch einen zweiten. Und man kann keine Diskette benutzen, was den Nutzen sehr einschränkt. Aber zum sparen habe ich gerade nicht die Kraft. Die Kellnerin ist unvermeidlich eine Studentin der Literaturwissenschaft, die üblicherweise andere Studenten der Literaturwissenschaft bedient. Zu ihnen ist sie professionell freundlich.
- Was darf ich euch bringen?
- Zwei Cappuchino, bitte.
- Gerne.
Obwohl sie diesen Dialog schon tausend Mal aufgeführt haben, ist da immer noch ein gewisses Lampenfieber. Werde ich den Warentausch verbal einleiten können? Ich vertiefe mich, wie man so sagt, in die Tageszeitung.
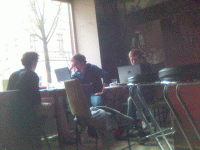
Wenn weder Chef noch Kollegen auf dich warten, wenn es überhaupt nichts bestimmtes ist, das dich aus dem Haus treibt, außer einem vagen Gefühl der Verpflichtung, das mit den Wochen immer unbestimmter wird ... dann dauert es lange. Ich stehe in der Küche. Ich spüle etwas Geschirr. Ich koche mir noch einen Kaffee. Ich trinke Kaffee und schaue aus dem Fenster in den engen Hinterhof hinein, obwohl es da außer einem ganz durchschnittlichen Fahrradständer und einer Wand nichts zu sehen gibt. Eine ganze Welt aus Hinterhöfen ... Ich drehe mir eine Zigarette, die Asche streife ich vorsichtig an der Fensterbank ab. Ich sollte mich also auf den Weg machen, denke ich. Ich schalte das Radio aus und stehe unentschlossen im Gang. Ich schalte den Fernseher an und stelle fest, daß nichts in den fünf Programmen sehenswert ist. Das alles dauert zwanzig Minuten. Es ist halb 12.
Auf die Straße. Die Kälte fasst mich an. Ich laufe bis zur Bushaltestelle und plötzlich sehe ich die Schuhe! Auf einer kleinen Mauer am Vorgarten abgestellt stehen sie, ein Paar schwarz glänzende Schuhe, offensichtlich kaum getragen. Und genau meine Größe! Vorsichtig schaute ich in alle Richtungen, dann nehme ich sie und packe sie in den Rucksack.
Wahrscheinlich haben sie dem Käufer nicht gepasst. Oder ein missglücktes Geschenk. Da stellte der Besitzer sie an die Straße; irgendwem werden sie eine Freude machen. Und der bin ich! Voller Freude stelle ich banale Überlegungen über europäische Mentalitätsunterschiede an: "So sind die Engländer!" (Den angemessenen Glanz erhält diese Tat erst durch ein Erlebnis in meiner süddeutschen Heimatstadt. Da schlich ein Bettler gebeugt durch die Fußgängerzone und bat flüsternd um Geld. Hinter ihm lief, mit rot erregtem Kopf, ein kleiner, dicker Mann, der jedes Mal den Passanten zurief: "Nichts geben! Nichts geben!" Schließlich besann sich der Bettler, dass wir uns unsere Würde selbst machen müssen, und bot dem Dicken Schläge an. Nach kurzem Handgemenge verzogen sich beide.)
Die wirklich Armen sehen anders. Bienen können bekanntlich Ultraviolettes sehen, deshalb bemerken sie Dinge, die den Menschen nicht auffallen, Strahlen, Verbindungen, andere Bedeutungen. So ist es mit dem Blick der Armen. Ich gehe durch die Stadt mit gesenktem Kopf, aber keine vergessene Zeitung entgeht mir, keine Pfandflasche, die ein paar Cent bringt. Den größten Teil meiner Einkünfte gebe ich aus für mein Zimmer. Vergnügungen und Kultur bringen Fernsehen und Radio. In die eigenen vier Wände.
Ich komme zu spät an im Sozialamt, alle Gänge leer, die Bürokraten beim Mittagessen. Ich fahre trotzdem in den 3. Stock, wo Neuanträge bearbeitet werden. Als der Fahrstuhl kommt, stampft mir eine alte Frau entgegen, voller Wut und mit rot unterlaufenen Augen. Beim Vorbeigehen räumt sie mit nicht den geringsten Platz ein. Als ich mich an ihr vorbei in den Fahrstuhl gezwängt habe, stockt mir wegen ihrem Gestank der Atem.
Ich finde die Tür mit dem Anfangsbuchstaben meines Nachnamens. Klopfe vorsichtig.
- Ja?
Meine Sachbearbeiterin, eine Frau mittleren Alters in einem bunten Strickpulli, ist überraschend nett.
- Was haben Sie denn gemacht bisher?
- Also, studiert vor allem.
Sie fragt geduldig weiter, wie ein Arzt seinen Patienten.
- Und was haben Sie studiert?
- Medien- und Kommunikationswissenschaft.
- Oh je, nicht noch einer!
Ich breche in Lachen aus, und eine Weile lachen wir also gemeinsam über diesen gelungenen Witz.
- Und? Abgeschlossen?
- Ja.
- Ich sag’s ja: unser Niveau steigt unaufhörlich.

Bei den Kommilitonen galt ich als verschroben, wenn sie überhaupt einen Gedanken auf meine Anwesenheit verwandten. Sie dagegen konnte ich kaum ertragen, ihr Gerede, Gehabe, sogar der Geruch. Medienwissenschaft, ein Mickey Mouse–Kurs, aber die geeignete Vorbereitung für den aufgeweckten Gymnasiasten mit Ambitionen. Sie konnten nicht verstehen, dass ich das alles ernst nahm. Sie waren keine Zyniker, sondern die Unterrichtsinhalte waren ihnen das Material, um die eigentlich wichtigen Fähigkeiten zu demonstrieren. Sie wurden Vermittlungsexperten, sozialpädagogische, politische, kulturelle Vermittlungsexperten. Ihre Aufgabe die Organisation der gesellschaftlichen Fabrik. Ihr Selbstbewusstsein war prekär, die Herren der Welt waren schließlich offensichtlich überflüssig. Die jungen Leute hatten eine gewisse Anspruchshaltung entwickelt. Sie wollten für ihre Meinungen bezahlt werden. Sie waren schon einmal im Ausland, auf eine sachliche Art gaben sie sich kosmopolitisch. Souverän bewegten sie sich im Internet. Sie dachten, sie seien sich für Anwärter der politischen Klasse. Aber auch das war eine Täuschung, denn solche Leute gestalten die gesellschaftliche Vermittlung nicht, sie illustrieren sie nur. Ihre Unsicherheit überspielen sie mit Arroganz, ihr größtes Talent ist Willfährigkeit.
Ich habe mich entschieden geweigert, mitzuschwätzen oder mitzumachen. Ich darf behaupten, dass ich in der deutschen Universität nur gesprochen habe, wenn eindeutig eine Note davon abhing. Ich verlegte mich aufs Obskure und schob vor allem das Erwerbsleben noch einige Zeit hinaus.
Eine renommierte soziologische Fachzeitschrift widmete eine ganze Ausgabe dem Thema soziale Exklusion. Ich las sie vorgestern in der Bücherei. Die Sozialwissenschaftler definieren "Exklusion" behelfsmäßig als Verarmung plus Isolation. Heinz Bude beschreibt darin verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren.
Das Schicksal des ‚aktiven Verlierers‘ besteht darin, nicht zu begreifen, was ihm widerfahren ist, weil er doch alles so gemacht hat, wie es verlangt wird. Er hat die Botschaft von Flexibilisierung und Mobilität ernstgenommen, hat sich umschulen lassen, ist umgezogen, hat sich scheiden lassen, um ganz neu anzufangen, und ist trotzdem aus dem Spiel gefallen. Der neue Arbeitgeber hat die dot.com – Krise nicht überlebt, die neue Freundin hat sich wieder von ihm getrennt, für die Arbeitsvermittlung war er ein Fremdkörper, und in der fremden Umgebung hat er keinen neuen sozialen Kontakt gefunden. (1)
In dieser luziden Beschreibung finde ich mich wieder. Auch darin, dass den sogenannten aktiven Verlierern der geordnete Rückzug verbaut ist, aus verschiedenen Gründen: aus Stolz oder weil die zuvor erworbenen Bildungstitel veraltet sind, weil die Freundschaften und Beziehungen von damals weggebrochen sind.

Wir haben zu improvisieren gelernt: die Kleidung vom Flohmarkt, professionelles Schwarzfahren, im Supermarkt klauen, woanders wurden Häuser besetzt. Unsere Überlebensstrategie bestand darin, unsere Lebenshaltungskosten zu senken, indem wir auf Konsum verzichten. Statt Arbeit gegen Konsum einzutauschen, wie das üblich ist. Ein aufgeblähtes Selbstbewusstsein trugen wir vor uns her, eine elitäre Überzeugung in unsere Originalität.
Nun verlieren Improvisation und Flohmarktkultur allmählich alles Elitäre. Was selbstgewählt und enthusiastisch war, wird zur Notwendigkeit für viele. Mir allerdings nützt die Improvisationsfähigkeit und Anspruchslosigkeit, um eine Art Elendsmobilität zu erhalten, um an dem Selbstbild als Journalist und Schriftsteller festzuhalten. Eine Weile noch.
Das ganze Laub muss herunter. Ich stapfe mit den neuen, aber hässlichen Schuhen durch die Biomasse am Boden, aufgeweichte Blätter, Dreck, Kippen. Jeden Dezember stelle ich fest, dass meine Turnschuhe undicht geworden sind und ich kaufe mir ein neues Paar. Ich bin auf dem Weg zum Arbeitsamt. Es gibt dort ein gesondertes Büro für die Akademiker. Die Besucherin, die im selben Zimmer wie ich ihren Antrag stellt, ist Biologin und gerade mit ihrer Promotion beschäftigt. Meine Sachbearbeiterin ist höchstens 25 Jahre alt. Hier ist der Umgangston schon wesentlich unfreundlicher als im Sozialamt. Ich setze mich, sie telephoniert gerade und nickt mir nur kurz zu.
- Nein ... also, Sie müssen den Termin schon einhalten ... wir kommen gegen diese Massen ja gar nicht mehr an ... beim besten Willen. Außer Sie wollen im Januar kein Geld, das müssen Sie entscheiden. Ja, tschüss!
Sie legt auf und wendet sich mir zu. Irgendwann fragt sie:
- Was haben Sie studiert.
Ich zähle auf:
- Medien- und Kommunikationswissenschaft, Neuere Geschichte und Anglistik.
- Aha. Also alles irgendwie.
Einen Moment lang fehlen mir die Worte. Zögernd sage ich:
- Genau. Alles irgendwie.

Müde am Flughafen. Wegen der angekündigten Sonderkontrollen bin ich besonders früh aufgestanden, nur um jetzt im Schnellrestaurant zu sitzen und zu schreiben. Für mich gehören Reflektion und Unterwegssein seit meiner Jugend zusammen: wegfahren, um zurückzuschauen. Ich habe den ersten Flieger nach London genommen, um Geld zu sparen, dafür zahle ich mit Schlaflosigkeit: vier Stunden, zu wenig. Kurz bevor ich gestern einschlief, während meine Gedanken hektisch um Geldbeträge und Textmengen weiterkreisten, kam mir plötzlich die Erkenntnis: „Wenn ich noch lange so weiter mache, bin ich irgendwann kaputt!“ Eine Warnung.
Beim Einchecken nehmen sie mir die Zahnpastatube ab. "Das sind 25 Milliliter zu viel!", ob ich die neuen Bestimmungen nicht gelesen habe? Für einen Moment wallt eine wilde, unbändige Wut in mir auf, Hass auf diese junge Frau mit maskenhaft geschminktem Gesicht und Zopf, die aussieht wie alle hier, die uns den Weg weisen und den Transport am Laufen halten. Die Tube war fast leer. Das flüchtige memento mori bei Start und Landung des Flugzeugs.
Während ich mühsam Minihonorare zusammentrage, drängen sich mir Gewaltphantasien auf. Wir schauen auf unser Leben und Persönlichkeit und alles, woran wir leiden dürfen, ist die übliche schlimme Kindheit. Die gab es früher auch. Wir leiden unter der Vergangenheit, und gäbe es sie nicht, die Gegenwart wäre kein Problem. Was in der Psyche gärt, soll das wirklich Wichtige sein, das Eigentlich, während sich „ein gesunder Mensch“ seine Lebensumstände nach Belieben schaffen kann.
Siddhartha schenkte sein Gewand einem armen Brahmanen auf der Straße. Er trug nur noch die Schambinde und den erdfarbenen ungenähten Überwurf. Er aß nur einmal am Tage, und niemals Gekochtes. Er fastete fünfzehn Tage. Er fastete achtundzwanzig Tage. Das Fleisch schwand ihm von Schenkeln und Wangen. Heiße Träume flackerten aus seinen vergrößerten Augen, an seinen dorrenden Fingern wuchsen lang die Nägel und am Kinn der trockne, struppige Bart. Eisig wurde sein Blick, wenn er Weibern begegnete; sein Mund zuckte Verachtung, wenn er durch eine Stadt mit schön gekleideten Menschen ging. Er sah Händler handeln, Fürsten zu Jagd gehen, Leidtragende ihre Toten beweinen, Huren sich anbieten, Ärzte sich um Kranke mühen, Priester den Tag für die Aussaat bestimmen, Liebende lieben, Mütter ihre Kinder stillen – und alles war nicht den Blick seines Auges wert, alles log, alles stank, alles stank nach Lüge, alles täuschte Sinn und Glück und Schönheit vor, und alles war uneingestandene Verwesung. Bitter schmeckte die Welt. Qual war das Leben. (2)
Macht Askese glücklich? Wenn du trotzdem unglücklich bist, hilft noch mehr Askese? Es ist wahr, ich neige zur äußersten Sparsamkeit, weil ich so oft niedergeschlagen bin. Aber ohne auf Konsum zu verzichten, könnte ich gar nicht tun, was ich tue, nicht arbeiten, wie ich arbeite. Es ist zu wenig die Rede von der produktiven Rolle der seelischen Störungen.
Nachts ist es kalt in Peters Wohnzimmer, ohne eine richtige Decke. Sein Mitbewohner geht als stummer Vorwurf durch das englische Reihenhaus. Er schreibt an einer Hausarbeit für die Uni und jeder Besuch strapaziert seine Nerven. Peter und ich unterhalten uns nur flüsternd. Ich greife zurück auf meine Freunde, weil ich mir kein Hotel leisten kann, aber habe weder Zeit, noch Lust, etwas mit ihnen zu unternehmen. Es gibt keine Spesen für diese Arbeitsreise. Für zwei kurze Radiobeiträge bekomme ich etwas mehr als 300 Euro, einen oder zwei Artikel kann ich über dieses Thema auch noch absetzen, das macht... zuwenig. Meinen Stundenlohn will ich gar nicht kennen; das Ergebnis einer ehrlichen Rechnung könnte ich nicht ertragen. Dazu kommt die Schwierigkeit, Arbeitszeit von Freizeit abzugrenzen, um eine solche Rechnung durchzuführen. Zu was zählt Zeitung lesen? Mein ganzer Aufenthalt hier ist notwendig, damit schließlich acht Minuten über den Sender gehen, wie viel davon ist Arbeitszeit.
Im Zweifelsfall: alles. Weil mir überlassen bleibt, wie ich meine Arbeit gestalte, habe ich nicht einmal einen Vorarbeiter, einen Kommandierenden, den ich mit Recht hassen dürfte. An solchen wie mir prallt die Agitation gegen den Neoliberalismus ab. Ich selbst treibe die Ökonomisierung voran, keine fremden Mächte. Wir selbst nutzen unsere Beziehungen als soziales Kapital und verwandeln sie so in Geld, unsere Umgangsformen als kulturelles Kapital etc.
Ich habe schnell die typische Berufskrankheit der Reporter entwickelt: die zwanghafte Themensuche. Ich gehe ins Kino und denke Feuilleton. Eine Freundin erzählt mir eine Anekdote, im Geiste übersetze ich ihre Erzählung in eine Glosse. Das Leben wird zu Material; kein Feierabend nirgends. Könnte ich jetzt vielleicht einen Moment lang nicht informiert werden? Mein empfindliches Fußnotengehirn. Ich fühle mich ausgebrannt, habe kaum neue Ideen. Ich produziere nur Varianten des alten Materials. Halbverdautes, flüchtig Durchdachtes, Oberflächliches. (Glücklicherweise ist etwas anderes gar nicht gefragt.) Noch zehre ich von meiner Studienzeit, finanziert mit der Erbschaft meines Großvaters und einem Stipendium. Sicher: wenn ihr wollt, kann ich arbeiten und nichts als arbeiten. Aber ich soll auch noch leben, wie soll das gehen?

Keinen einzigen Schritt mehr. Es geht einfach nicht. Das harte Leder hat sich durch die Haut an Ferse bis ins Fleisch gerieben, jede Bewegung schmerzt, als triebe jemand mir Nägel ins Fleisch. Was für eine idiotische Idee, die ungetragenen Schuhe für dieses Treffen anzuziehen, nur um den Redakteur zu beeindrucken. 1.300 Euro, einen Monat viel Arbeit und danach genug Geld für einen weiteren. Eine Chance. Eine Chance auf eine Chance. Eine Chance auf eine Chance auf einen Fuß in der Tür, die fällt zu und bricht dir die Zehen.
Der Redakteur sagt mir beim ersten Telephonat zu, beim zweiten kann er sich nicht mehr erinnern. Er verteilt Arbeit, als wäre es eine Wohltat. Eine Redakteurin erzählt, sie bekäme zwischen fünfzig und hundert Angeboten in der Woche, zu vergeben hat sie einen Sendeplatz. Dafür will sie Mitleid. Höflich bleiben.
Den Nachhauseweg laufe ich auf Zehenspitzen. Das Blöken der Teenager auf der Straße, der Wind kalt wie Metallnadeln. Ich weiche den Mädchen auf dem Bürgersteig aus. Alt bin ich geworden. Oder vielleicht nur: morbide geblieben. Die Strafe der späten Geburt.
Ich spreche in Zitaten, weil mir die Worte fehlen. Man verschlägt mir die Sprache.
An dem, was wir tun, klebt ein Rest Nimbus. Er hat mit unserer sozialen Situation nichts zu tun. Tanja zum Beispiel. Wenn sie sagt, dass sie „beim Film“ ist, nicken sie anerkennend. Letzten Monat drehte sie einen Horrorfilm im Brandenburgischen, im Wald. Mit undichten Schuhen, also nassen Füssen, denn für neue ist kein Geld da. Zur Pressekonferenz im Bundestag fahre ich mit dem Fahrrad, weil ich mir eine Fahrkarte nicht leisten kann. Durch den kalten Berliner Winterregen, als ich ankomme bin ich durchweicht und verschwitzt. Die Journalisten schauen misstrauisch, als ich mich in die letzte Reihe setze. Auf dem Rückweg höre ich noch auf dem Fahrrad mit dem Mobiltelephon meine Mailbox ab.
Dann, und das ist das schlimmste, gibt es noch welche, die halten selbst, gegen alle Evidenz, daran fest, sie seien die Vorarbeiter in der Kulturindustrie, schlecht oder nicht entlohnt, aber Boheme seit dreißig Jahren. Wer meinen Bekannten Stefan fragt, was er tut, bekommt die Antwort "Regieassistent". Weil Stefan das vor fünf Jahren einmal war. Heute arbeitet er in einem Marktforschungsbüro, das nicht ertragen könnte, wüsste er nicht, dass er eigentlich etwas ganz anderes tut.

Am nächsten Tag probierte er die Schuhe. Das würde gehen, etwas Platz in den Spitzen, aber ein guter Halt. Nur eines störte: in die Sohle der Schuhe war hinten eine kleine Metallplatte eingelassen; dadurch wurde jeder Schritt von einem lauten Klick begleitet. Das ließ sich gar nicht vermeiden, selbst wenn er zuerst die Fußspitzen aufsetzte und dann langsam die Ferse senkte. Er konnte er sich also von diesem Tage an nur noch sehr langsam fortbewegen. Aber das machte ja nichts; er hatte Zeit. Wenn er morgens so zur Haltestelle ging, und der Bus fuhr ab, was machte das? Es kam ja bald der nächste. So begann ein Lebensabschnitt, der geprägt war von Vorsicht und Vorausschau, von Gründlichkeit und Armut.
Nie zuvor hatte er sich so alleine gefühlt. In dieser Stadt, bewohnt von Millionen, kannte er nicht einen einzigen Menschen. Ihn verlangte so nach Kontakt, nach Berührung, dass er es tatsächlich auf seiner Haut spürte. Eines Abends machte er eine Entdeckung. Als er auf dem Nachhauseweg an einem kleinen Theater vorbeiging, öffneten sich dort die Türen und viele Menschen kamen heraus, gingen aber nicht weg, sondern unterhielten sich und zündeten Zigaretten an. Theaterpause! Er zögerte nicht, ging näher zum Eingang, als ob er die Glasvitrinen mit den Ankündigungen betrachten wolle, dann mit schlenderndem Schritt durch die Tür, hinein. Drinnen wartete er, bis die Besucher ihre Plätze wieder eingenommen hatten, dann setze er sich mit einem Gefühl des Triumphs. Große Werke der Weltliteratur würde er dargeboten bekommen. Wenigstens den 2. Akt.
Er lebte von Resten, nicht gut, aber er lebte. Fast nie ging ein Geldstück durch seine Hände. Die Überweisung des Sozialamts überwies er vollständig weiter an die Vermieterin, die sich auch nicht beschwerte, wenn er einmal zwei oder drei Wochen in Rückstand geriet. Er sprach oft wochenlang kein Wort, nickte höchstens oder schüttelte den Kopf, wenn er angesprochen und nach dem Weg gefragt wurde oder ob er noch ein Getränk wolle oder ob er mit aufs Zimmer, "ganz in der Nähe", käme.
- Nein. Danke.
Seine Stimme klang heiser, wie ein Räuspern.
- Ich. Muss. Nach. Hause.
Er sprach die Worte langsam und nacheinander aus. Er behandelte sie wie ein Weinkenner, der einen seltenen Jahrgang prüft. "Das sind nicht meine Worte", dachte er, "sie kommen aus meinem Mund, aber sie gehören nicht mir. Mir gehören eigentlich nur die kleinen Pausen zwischen ihnen."
Der Gedanken gefiel ihm, und er lächelte plötzlich. Mit den Worten würde er es genauso machen wie mit allem anderen: er würde sie einfach benutzen, obwohl sie nicht für ihn gedacht waren. So wie er sich mit den gefundenen Brettern ein Regal gebaut hatte, würde er Sätze bauen nach seinen Wünschen.
(1) Heinz Bude (2004) Das Phänomen der Exklusion: Der Widerstreit zwischen gesellschaftlicher Erfahrung und soziologischer Rekonstruktion. In: Mittelweg 36. 4/2004. 3 – 15.
(2) Hermann Hesse, Siddhartha, S. 13.